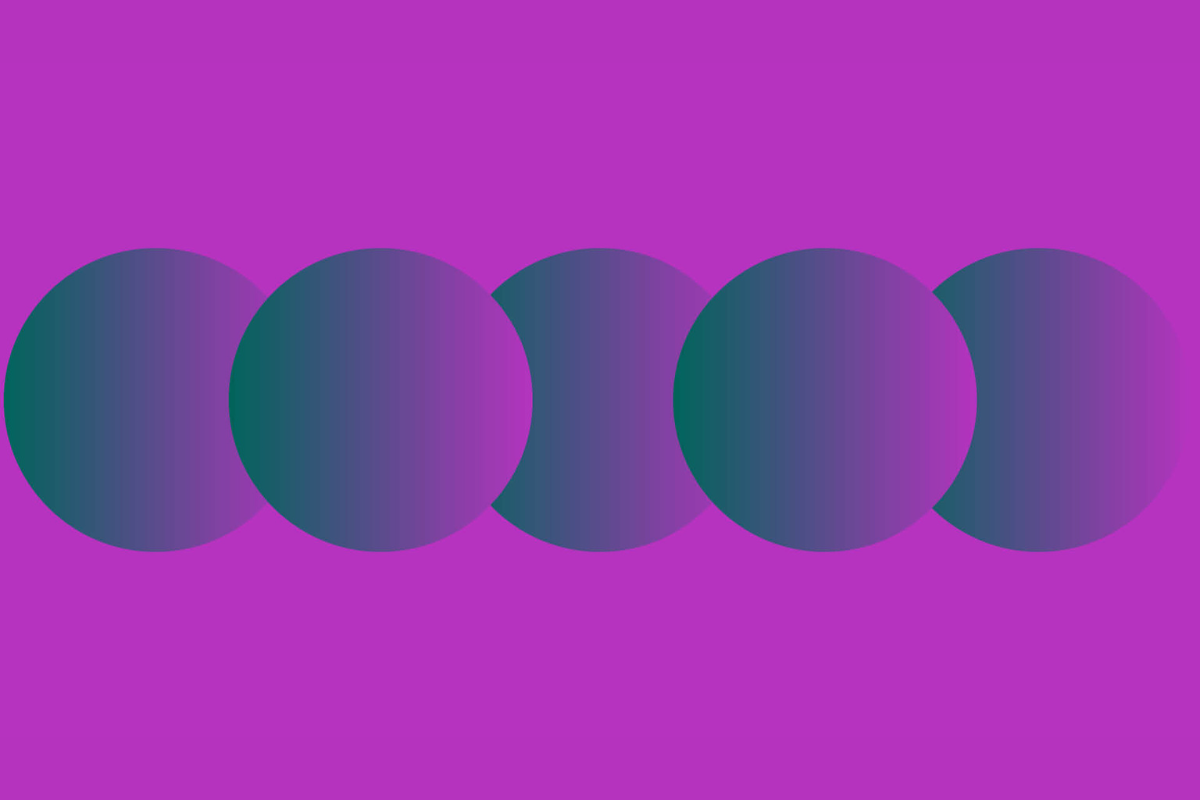Es handelt sich um einen leicht geänderten Auszug aus dem Buch „Hyperconnectivity and Its Discontents“ (Polity Press, 2022).
Exklusive Erstübersetzung aus dem Englischen von Dennis Yücel
auf englisch/in english
This essay is adapted from Rogers Brubaker, Hyperconnectivity and Its Discontents (Polity Press, 2022).
Digital connectivity once stood for democratization and participatory forms of citizenship. Today, however, the rise of social networks are increasingly discussed in terms of political crisis. Sociologist Rogers Brubaker shows how regimes of “hyperconnectivity” foster both populism and its apparent antithesis, technocracy.
For at least 30 years – from the 1980s through the middle of the last decade, digital connectivity seemed full of democratic promise. It ushered in a fundamental shift in the ecology of public communication, characterized by Manuel Castells as a shift from unidirectional mass communication to multidirectional “mass self-communication.” This new ecology of communication, it was thought, would promote more participatory forms of citizenship, bring previously excluded or marginalized groups into the polity, and contribute to undermining authoritarian regimes.
This story got many elements right, but it got other things badly wrong. Instead of making politics more transparent, digital hyperconnectivity – a regime of communication in which everyone and everything is connected to everyone and everything else, everywhere and all the time – has fragmented the public sphere and made politics more opaque. Micro-targeting practices, guided by sophisticated behavioral science, have diffused from the realm of commerce to that of politics. Platform companies’ opaque and proprietary algorithms determine who sees what in the digital public sphere, which loses thereby its “public” quality. Encrypted messenger services have allowed political campaigns, especially in the developing world, to spread rumors and mobilize fear while avoiding public accountability.
Since the middle of the last decade, the digital dream of renewing democratic citizenship has been challenged and partly overshadowed by a digital nightmare of undermining democratic citizenship by short-circuiting reasoned deliberation, nurturing conspiracy theories, intensifying polarization, and incubating extremism. And authoritarian regimes, even if they were initially unprepared for the nimbleness and creativity of digitally mediated opposition movements, have long since learned to monitor and counter such movements. The most sophisticated of such regimes, led by China, have entrenched their power through massively enhanced capacities for digital surveillance.
Paradoxes of Disintermediation
Digital nightmares can be just as seductive – and just as distorting – as digital dreams. So I want to resist the temptation to replace digital boosterism with digital doomsterism – and the temptation to blame hyperconnectivity, and social media in particular, for contemporary political ills that in fact have deep pre-digital roots. It’s not that I want to offer a more optimistic account. But I want to step back from grand boosterish or doomsterish narratives to consider how hyperconnectivity has paradoxically fostered both populism and its seeming antithesis, technocracy.
Digital hyperconnectivity accentuates the chronic populism of late modern societies in two main ways. First, it is a technology – and an ideology – of immediacy. By circumventing or disrupting institutional intermediaries of all kinds, hyperconnectivity promises to connect people directly to news and information, audiences directly to creators, and citizens directly to political leaders.
Complete disintermediation is of course a myth: hyperconnectivity simply replaces visible intermediaries with self-invisibilizing ones. Digital platforms remain intermediaries even when they disavow that role and present themselves instead as neutral conduits and facilitators. But the promise of immediacy is not entirely illusory. The bypassing or weakening of existing intermediaries is real and important. Digitally mediated connections can feel direct and immediate, and President Trump’s connection with his legions of Twitter followers was more direct and immediate than the usual institutionally mediated and filtered connections between politicians and citizens. Citizens’ relation to public knowledge claims, though algorithmically filtered, is indeed more immediate than it was when public knowledge was primarily organized by the three major American television networks – or a single state public broadcaster in some other countries.
The ideology of disintermediation is powerfully attractive, and it is precisely a populist ideology. For populism is itself an ideology of immediacy. It promises to empower ordinary people by disempowering mediating institutions and the elites that appear comfortably ensconced in them. In the political sphere, populism delegitimizes political parties, professional expertise, courts, and the mainstream media and demands an immediate or direct relation between “the people” and the exercise of power.
A Digital Public for “the People”
The second way in which hyperconnectivity fosters populism is by contributing to the popularization of culture and politics. It does so in one sense by opening up more accessible and engaging forms of cultural and political participation and broadening the range of participants. Digital platforms have made it much easier for those outside the cultural or political mainstream, including the disaffected citizens to whom populist politicians often appeal, to find like-minded others and establish a public presence.
The networked digital public sphere contributes to popularization in a second sense by making calculations of popularity – and representations of what “the people” as a whole or some particular public like, want, prefer, and believe – more central to culture and politics. Technologies of continuous and granular quantification render “the people” visible and knowable in new ways. Digitally mediated ways of consulting constituencies and registering their preferences have been at the forefront of digital democracy initiatives. And renderings of the popular have become central to the everyday workings of culture and politics. Ubiquitous “trending” algorithms, for example, do not simply register what is popular for a particular public at a particular moment: they amplify and reinforce the popularity that they register. The digitally networked public sphere thus enshrines popularity as the ultimate arbiter of value.
Hyperconnectivity contributes to popularization in a final sense by strongly favoring popular cultural and political styles, that is, “low” styles rather than “high” styles. “Low” styles are attention-seeking and taboo-breaking; they flout the constraints and restraints of polite speech and political correctness. They incline toward confrontation, emotionalization, personalization, and hyper-simplification. Such “low” styles were already favored by the pre-digital mediatization of politics. But they are even more strongly favored in the highly competitive digital attention economy – and in what might be called the “attention polity.” They have the best chance of gaining traction by breaking through the glut of superabundant digital content.
Hyperconnectivity Fosters Both Populism and Technocracy
The ecology of hyperconnectivity thus has deep affinities with the logic of populism. In the cultural domain, it erodes the power of gatekeepers, engenders new forms of popular creativity, and universalizes metrics that record and amplify popularity. In the political sphere, it allows “ordinary” people – disaffected citizens in particular – to be addressed directly; it facilitates the emergence of counter-publics; and it rewards the “low” political styles that are best suited to mobilizing against the establishment.
Yet at the same time, the new modes of algorithmic governance enabled by hyperconnectivity are deeply technocratic. Algorithmic governance has been adopted by underresourced and overburdened government agencies (such as police departments and social welfare agencies), drawn by the superabundance – and ideological celebration – of data and by promises of objectivity, efficiency, and cost savings. But algorithmic governance is not restricted to governments. It is in fact much more developed in the private sector, especially by the great tech platforms themselves. The platforms, after all, have the data and machine learning expertise to employ much more sophisticated forms of algorithmic governance. And platforms are certainly involved in the business of governing. In the most obvious sense, they govern the activities of their users through their design and control of the digital architectures that determine what can be done on the platforms. But their governing power extends to public life more broadly. Most crucially, they govern who sees what – and who can say what – in the digital public sphere.
Algorithmic governance is premised on specialized knowledge: on knowledge generated by complex computational procedures that analyze large volumes of data. The justification for entrusting decision-making to such procedures is that the knowledge they generate – and their capacity to find the optimal solutions for precisely defined problems – is superior to the knowledge and optimizing capabilities of even the most highly trained humans.
Technocratic ideals also underlie and animate the broader spirit of what Evgeni Morozov calls “technological solutionism.” Solutionist thinking, like technocracy in general, is depoliticizing. It seeks to transform social and political problems into technical problems. It thus exemplifies the “assimilation of politics to engineering” that Michael Oakeshott saw as characteristic of rationalist politics in general.
Technocracy and populism are generally understood to be antithetical. While technocracy entrusts decision-making powers to experts (or to expert-designed knowledge procedures like algorithms), populism distrusts the claims of expertise in politics. And while technocracy is depoliticizing, seeking to insulate decision-making from popular interference, populism is generally re-politicizing; it claims to reassert political control over issues that are seen as having been illegitimately removed from the domain of democratic decision-making and entrusted to unaccountable bureaucrats, experts, or courts. As decision-making by unaccountable algorithms (and by the unaccountable platforms or experts that design them) becomes increasingly important, one might therefore expect it to become similarly vulnerable to populist challenge.
Yet there are reasons to believe that algorithmic governance may remain insulated from such challenge. Content moderation on major platforms became both more automated and more visible and intrusive during the pandemic and during and after the 2020 US election. And this did prompt user complaints about censorship and liberal bias. Yet it did not generate a populist challenge to algorithmic content moderation per se. Algorithms are not only unaccountable; they are in a sense unaddressable. Unlike courts, bureaucratic agencies, or expert panels that publish their rulings and recommendations, they do not make easy targets. Algorithms are self-invisibilizing, protected by their opacity. They are also protected by the fact that they work in a granular, case-specific manner. Algorithmic governance has of course become an important focus of contestation. But the contestation is carried out in a technical idiom: specialized knowledge of algorithms is required in order to contest the specialized knowledge encoded in algorithms.
The Logic of Technopopulism
More fundamentally, as Christopher Bickerton and Carlo Invernizzi Accetti have argued, the reciprocal antagonism of populism and technocracy conceals an underlying affinity: both are opposed to the complex and messy institutional mediations of party democracy. As the structural foundations of party democracy have eroded in the last half-century, political competition has come to be structured increasingly by what they call a “technopopulist” political logic, characterized by conjoined appeals to “the people” on the one hand and to problem-solving “competence” on the other.
Bickerton and Invernizzi Accetti are not concerned with new communications technologies; the “techno” in their “technopopulism” refers to technocracy, not to technology. Yet hyperconnectivity powerfully reinforces the synthesis of populism and technocracy that they describe. As a technology and ideology of immediacy, it exacerbates the very crisis of institutional mediation to which it claims to respond; it contributes in particular to the hollowing out of parties and of the press as mediating institutions. As a technology of the popular, hyperconnectivity generates new ways of mobilizing, consulting, and measuring “the people” and new ways of claiming to act on their behalf. And as a technology of knowledge, it affords new ways of knowing and governing the social world, new ways of recasting social problems as technical problems. If technopopulist appeals to “the people” and to expertise increasingly “structure our politics and shape our experience of democracy,” as Bickerton and Invernizzi Accetti argue in the final sentence of their book, hyperconnectivity increasingly structures and shapes appeals to “the people” and to expertise. The “techno” in technopopulism may thus indeed refer to technology as well as to technocracy.
Während der letzten 30 Jahre – von den 1980ern bis in die Mitte des letzten Jahrzehnts – erschien die digitale Vernetzung voller demokratischer Versprechen. Sie führte zu einem grundlegenden Wandel des Ökosystems der öffentlichen Kommunikation, den Manuel Castells als Wandel von der unidirektionalen Massenkommunikation zur multidirektionalen „Massenselbstkommunikation“ beschrieb.
Diese Erzählung traf in vielerlei Hinsicht zu. Bei anderen Punkten jedoch lag sie völlig falsch.
Statt Politik transparenter zu machen, hat digitale Hyperkonnektivität – ein Kommunikationsregime, in dem jeder und alles mit jedem und allem verbunden ist, überall und jederzeit – den öffentlichen Raum fragmentiert und Politik undurchsichtiger gemacht.
Eine von ausgeklügelter verhaltenswissenschaftlicher Forschung geleitete Praxis des Micro-Targetings hat sich von der Geschäftswelt auf die Politik ausgebreitet. Undurchsichtige und urheberrechtlich geschützte Algorithmen von Plattformunternehmen bestimmen, wer was in der digitalen Öffentlichkeit sieht, die dadurch gerade ihre „öffentliche“ Qualität einbüßt. Verschlüsselte Messenger-Dienste ermöglichen politischen Kampagnen vor allem in Entwicklungsländern, Gerüchte zu streuen und Ängste zu schüren, während sie sich öffentlicher Rechenschaft entziehen.
Der digitale Traum von der Erneuerung der demokratischen Gesellschaft wird seit Mitte des letzten Jahrzehnts zunehmend brüchig. Teilweise wird er von einem digitalen Albtraum überschattet, der die demokratische Gesellschaft unterminiert, indem er den Prozess vernunftgeleiteter Meinungs- und Willensbildung kurzschließt, Verschwörungstheorien nährt, Polarisierung verschärft und Extremismus begünstigt. Was autoritäre Regime betrifft, so haben sie, wenn sie auch anfangs nicht auf die Agilität und Kreativität digital medialisierter Oppositionsbewegungen vorbereitet waren, längst gelernt, derartige Bewegungen zu überwachen und zu bekämpfen. Die raffiniertesten Regime dieser Art, allen voran China, haben ihre Macht durch massiv gesteigerte Fähigkeiten der digitalen Überwachung längst gefestigt.
Paradoxien der Dismediation
Digitale Albträume können genauso verführerisch – und verzerrend – sein wie digitale Träume. Ich will also der Versuchung widerstehen, digitale Boomstories durch digitale Doomstories zu ersetzen – der Versuchung, Hyperkonnektivität und insbesondere die sozialen Medien für politische Missstände der Gegenwart verantwortlich zu machen, die ihre Wurzeln in Wahrheit im prä-digitalen Zeitalter haben.
Ich will nicht unbedingt eine optimistischere Sicht der Dinge anbieten. Aber ich möchte einen Schritt zurück von den großen Erzählungen über Aufstieg und Niedergang gehen und darüber nachdenken, wie Hyperkonnektivität paradoxerweise sowohl den Populismus als auch seinen scheinbaren Gegenpol, die Technokratie, begünstigt hat.
Digitale Hyperkonnektivität bringt den chronischen Populismus der spätmodernen Gesellschaften in zweierlei Hinsicht zur Geltung.
Vollständige Dismediation ist natürlich ein Mythos: Hyperkonnektivität ersetzt lediglich sichtbare Vermittler durch solche, die sich selbst unsichtbar machen. Digitale Plattformen bleiben Vermittler, auch wenn sie diese Rolle verleugnen und sich lediglich als neutrale Kanäle und Moderatoren präsentieren. Doch das Versprechen der Unmittelbarkeit ist nicht völlig illusorisch. Die Umgehung oder Schwächung bestehender Vermittler ist real und fällt ins Gewicht. Digital vermittelte Verbindungen können sich direkt und unmittelbar anfühlen, und die Verbindung von Präsident Trump mit seinen Legionen von Twitter-Followern war direkter und unmittelbarer als die üblichen institutionell vermittelten und gefilterten Verbindungen zwischen Politikern und Bürgern. Der Zugang von Bürgern zu öffentlichen Informationen ist, obwohl algorithmisch gefiltert, in der Tat unmittelbarer als zu der Zeit, als öffentliche Informationen in erster Linie von den drei großen amerikanischen Fernsehnetzwerken aufbereitet wurden – oder einer einzigen staatlichen Sendeanstalt in einigen anderen Ländern.
Die Ideologie der Dismediation übt eine starke Anziehungskraft aus, und es handelt sich dabei um eine distinktiv populistische Ideologie. Populismus ist selbst eine Ideologie der Unmittelbarkeit. Er verspricht, gewöhnliche Menschen zu ermächtigen, indem er die vermittelnden Institutionen mitsamt den Eliten entmachtet, die sich dort eingerichtet zu haben scheinen. In der politischen Sphäre delegitimiert der Populismus politische Parteien, Fachwissen, Gerichte und die Mainstream-Medien. Er fordert eine unmittelbare oder direkte Verbindung zwischen „dem Volk“ und der Ausübung von Macht.
Eine digitale Öffentlichkeit für „das Volk“
Die zweite Art und Weise, in der Hyperkonnektivität den Populismus stärkt, besteht in ihrem Beitrag zur Popularisierung von Kultur und Politik. Hyperkonnektivität eröffnet zugänglichere, einladendere Formen der kulturellen und politischen Partizipation und vergrößert die Bandbreite an Teilnehmern.
Digitale Plattformen haben es Menschen, die außerhalb des kulturellen oder politischen Mainstreams stehen, einschließlich der unzufriedenen Bürger, an die sich populistische Politiker oft richten, ungemein leichter gemacht, Gleichgesinnte zu finden und öffentliche Präsenz zu zeigen.
Die vernetzte digitale Öffentlichkeit trägt zur Popularisierung noch in einem zweiten Sinne bei: Sie rückt die Berechnung von Popularität und die Darstellung dessen, was „das Volk“ als Ganzes oder in Form einer bestimmten Öffentlichkeit mag, will, bevorzugt und glaubt, in den Fokus von Kultur und Politik.
Technologien der kontinuierlichen und granularen Quantifizierung machen „das Volk“ auf neue Weise sicht- und erkennbar. Digital vermittelte Möglichkeiten, Wähler zu befragen und ihre Einstellungen zu erfassen, bilden die Speerspitze von Initiativen für digitale Demokratie.
Hyperkonnektivität trägt schließlich zur Popularisierung bei, indem sie populäre kulturelle und politische Stile stark begünstigt, das heißt „niedere“ gegenüber „hohen“ Stilen.
Hyperkonnektivität stärkt Populismus und Technokratie gleichermaßen
Das Ökosystem der Hyperkonnektivität ist somit eng mitder Logik des Populismus verwandt. Im kulturellen Bereich untergräbt sie die Macht von Gatekeepern, schafft neue Formen populärer Kreativität und universalisiert Kennzahlen, die Popularität messen und verstärken. In der politischen Sphäre können „gewöhnliche“ Menschen – insbesondere unzufriedene Bürger – direkt angesprochen werden; sie ermöglicht die Entstehung von Gegenöffentlichkeiten und belohnt „niedere“ politische Stile, die sich am besten zur Mobilisierung gegen das Establishment eignen.
Gleichzeitig jedoch sind die neuen Formen algorithmischer Governance, die durch Hyperkonnektivität möglich wurden, zutiefst technokratisch. Algorithmische Governance wurde zunächst von unterfinanzierten und überlasteten Behörden (etwa der Polizei oder Sozialämtern) eingeführt. Sie wurden angezogen von der Überfülle an Daten – und deren ideologischer Beweihräucherung – sowie dem Versprechen von Objektivität, Effizienz und Kosteneinsparung. Doch algorithmische Governance ist nicht auf staatliche Stellen beschränkt. Tatsächlich ist sie im Privatsektor viel stärker verbreitet, insbesondere bei den großen Technologieplattformen selbst. Am Ende verfügen die Plattformen über das Know-How in Datenverarbeitung und maschinellem Lernen, um weitaus ausgefeiltere Formen der algorithmischen Governance umzusetzen. Und die Plattformen sind zweifellos im Geschäft des Regierens aktiv. Im offensichtlichsten Sinne regieren sie über die Aktivitäten ihrer Nutzer durch Design und Kontrolle der digitalen Architekturen, die bestimmen, was Nutzer auf den Plattformen tun können. Doch ihre Regierungsgewalt erstreckt sich auch auf das öffentliche Leben im Allgemeinen. Entscheidend ist, dass sie bestimmen, wer was in der digitalen Sphäre sehen – und sagen – kann.
Algorithmische Governance basiert auf spezialisiertem Wissen: Wissen, das durch komplexe Rechenverfahren generiert wird, die große Datenmengen analysieren. Als Rechtfertigung dafür, derartigen Verfahren Entscheidungskompetenz anzuvertrauen, wird angeführt, dass das von ihnen generierte Wissen – und ihre Fähigkeit, optimale Lösungen für genau definierte Probleme zu finden – dem Wissen und den Optimierungsfähigkeiten selbst der am besten ausgebildeten Menschen überlegen ist.
Technokratische Ideale begründen und beleben auch den generellen Geist dessen, was Evgeni Morozov „technologischen Solutionismus“ nennt. Solutionistisches Denken ist, wie die Technokratie im Allgemeinen, entpolitisierend. Es zielt darauf ab, soziale und politische Probleme in technische Probleme zu verwandeln. Dies ist ein Beispiel für die „Assimilation von Politik an die Technik“, in der Michael Oakeshott ein Charakteristikum der rationalistischen Politik im Allgemeinen sah.
Technokratie und Populismus werden gemeinhin als Gegensätze verstanden. Während Technokratie die Entscheidungsgewalt Experten (oder von Experten entwickelten Wissensverfahren wie Algorithmen) anvertraut, misstraut der Populismus dem Kompetenzanspruch von Expertenwissen in der Politik. Und während die Technokratie entpolitisierend wirkt und versucht, Entscheidungsprozesse von einer Einmischung der Bevölkerung fernzuhalten, wirkt der Populismus im Allgemeinen repolitisierend; er beansprucht, die politische Kontrolle über Fragen wiederzuerlangen, die aus seiner Sicht unrechtmäßig dem Bereich der demokratischen Entscheidungsfindung entzogen und nicht rechenschaftspflichtigen Bürokraten, Experten oder Gerichten anvertraut wurden.
Da Entscheidungsprozesse durch nicht rechenschaftspflichtige Algorithmen (und durch nicht rechenschaftspflichtige Plattformen oder Experten, die sie entwickeln) immer mehr Raum einnehmen, könnte man annehmen, dass sie ähnlich angreifbar für populistische Attacken werden.
Es gibt jedoch Gründe für die Annahme, dass algorithmische Governance von solchen Angriffen verschont bleiben könnte. Im Zuge der Pandemie sowie der amerikanischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 wurde die Content-Moderation auf den großen Plattformen sowohl stärker automatisiert als auch sichtbarer und durchgreifender. Dies führte zu Beschwerden von Nutzern über Zensur und liberalen Bias. Es führte jedoch nicht zu einer populistischen Infragestellung algorithmischer Content-Moderation an sich. Algorithmen sind nicht nur nicht rechenschaftspflichtig, sie sind gewissermaßen auch nicht ansprechbar. Im Gegensatz zu Gerichten, bürokratischen Behörden oder Expertengremien, die ihre Urteile und Empfehlungen veröffentlichen, geben sie keine leichten Ziele ab. Algorithmen machen sich selbst unsichtbar, geschützt durch ihre Undurchsichtigkeit. Sie sind auch dadurch geschützt, dass sie granular und fallspezifisch arbeiten. Natürlich ist algorithmische Governance zu einem heiß umkämpften Feld geworden. Die Diskussion erfolgt jedoch in der Fachsprache der Technik: Es ist Spezialwissen über Algorithmen erforderlich, um das in Algorithmen kodierte Spezialwissen zur Diskussion zu stellen.
Die Logik des Technopopulismus
Hinter dem wechselseitigen Antagonismus von Populismus und Technokratie verbirgt sich, wie Christopher Bickerton und Carlo Invernizzi Accetti argumentiert haben, eine grundlegende Affinität: Beide richten sich gegen die komplexen und vertrackten institutionellen Vermittlungen der Parteiendemokratie. Da die strukturellen Grundlagen der Parteiendemokratie im letzten halben Jahrhundert erodiert sind, wird der politische Wettbewerb zunehmend durch eine politische Logik strukturiert, die sie als „technopopulistisch“ bezeichnen, und die sich durch die gleichzeitige Berufung auf „das Volk“ auf der einen und problemlösende „Kompetenz“ auf der anderen Seite auszeichnet.
Bickerton und Invernizzi Accetti befassen sich nicht mit neuen Kommunikationstechnologien; das „Techno“ in ihrem „Technopopulismus“ bezieht sich auf Technokratie, nicht auf Technologie. Hyperkonnektivität verstärkt jedoch die von ihnen beschriebene Synthese aus Populismus und Technokratie immens. Als Technologie und Ideologie der Unmittelbarkeit verschärft sie genau jene Krise der institutionellen Vermittlung, auf die sie zu reagieren vorgibt; sie trägt insbesondere zur Aushöhlung von Parteien und Presse als vermittelnde Institutionen bei. Als Technologie des Populären schafft Hyperkonnektivität neue Wege, „das Volk“ zu mobilisieren, zu befragen und zu vermessen, und neue Wege, um vorzugeben, in seinem Namen zu handeln. Und als Wissenstechnologie bietet sie neue Wege, die soziale Welt zu erfassen und zu regieren, neue Wege, soziale Probleme als technische Probleme zu formulieren. Wenn die technopopulistische Berufung auf „das Volk“ und das Expertenwissen zunehmend „unsere Politik strukturieren und unsere Erfahrung von Demokratie prägen“, wie Bickerton und Invernizzi Accetti im letzten Satz ihres Buches argumentieren, dann strukturiert und formt Hyperkonnektivität zunehmend diese Berufung auf „das Volk“ und das Expertenwissen. Das „Techno“ in Technopopulismus kann sich also sowohl auf Technologie als auch auf Technokratie beziehen.