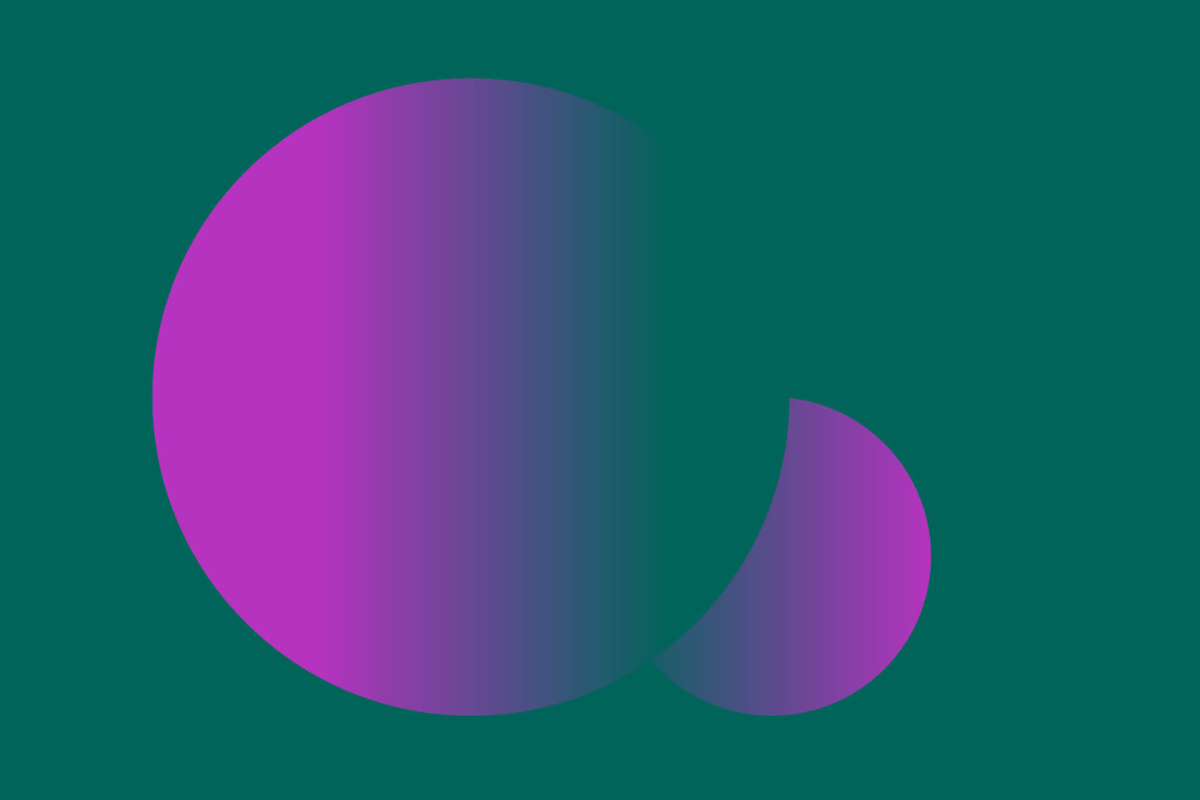Die Fragen stellte Sebastian Hoppe aus der Kuration des Themenkanals Umbruch | Krieg | Europa.
Das Interview wurde vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023 geführt. Die Ereignisse finden somit im Gespräch keine Berücksichtigung.
Sebastian Hoppe: Herr Kumkar, was meinen wir heute, wenn wir jemanden als Experten bezeichnen?
Nils Kumkar: Das Alltagsverständnis des Begriffs sagt erstmal nur, dass jemand ein Experte ist, der sich wirklich gut mit etwas auskennt. Das ist die absolute Minimaldefinition. Soziologisch betrachtet ist das natürlich unbefriedigend, denn in diesem Fall ist jeder Experte für irgendwas und alle für ihr eigenes Leben. Die aus meiner Sicht fruchtbarste Art und Weise, den Begriff aus sozialwissenschaftlicher Perspektive anzugehen, ist rollenzentriert.
SH: Was genau bedeutet das?
NK: Wir sollten nicht vom Inhalt des Wissens oder von der Güte des Wissens ausgehen – auch weil wir das in den meisten Fällen ja als Laien gar nicht beurteilen können – sondern davon, wie dieses Wissen gesellschaftlich bearbeitet wird. Es gibt diese sperrige Formulierung in der Wissenschaft: Experten sind Leute mit der institutionalisierten Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit.
SH: Deckt das nicht nur eine bestimmte Gruppe von Experten ab, nämlich jene, die beispielsweise ins Auswärtige Amt oder ins Gesundheitsministerium gehen und dann hoffen, dass ihre Empfehlungen berücksichtigt werden? Was ist mit der über Medien verbreiteten Expertise, die sich gar nicht in erster Linie an die Politik, sondern an die Fernseh- oder Online-Öffentlichkeit wendet?
NK: An diesem Punkt wird es interessant. Allerdings müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir sollten davon ausgehen, dass es so etwas wie Expertise tatsächlich braucht. Das kann man über die Nachfrageseite am besten verstehen. Politik hat die Funktion, kollektiv bindende Entscheidungen vorzubereiten. Das kann sie nur auf Basis eines Bildes davon, wie die Dinge nun mal sind. Hierfür holt sie sich Expertise. Allerdings ist an dieser Stelle eine Übersetzungsleistung notwendig, die alles andere als trivial ist. Denn in der Wissenschaft finden wir in der Regel überhaupt nicht heraus, wie die Dinge sind, sondern wir überprüfen, was unplausibel, unwahr oder nicht wahrscheinlich ist. Dort, wo die Wissenschaft Wahrheiten anbietet, tut sie das für gewöhnlich unter dem Vorbehalt, dass es konsequenzenlos bleibt.
Dort, wo die Wissenschaft Wahrheiten anbietet, tut sie das für gewöhnlich unter dem Vorbehalt, dass es konsequenzenlos bleibt.
SH: In der Regel sind politische Entscheidungen alles andere als konsequenzenlos.
NK: So ist es. Wird man als Experte nachgefragt, muss man auf einmal eine ganz andere Form von Wissen bereitstellen. Dann beginnen die Schwierigkeiten, wie man im Verlauf des 20. Jahrhunderts gut beobachten kann. Politik wird als immer komplizierter wahrgenommen und insbesondere in der Demokratie steht die Expertise ständig im Verdacht, parteiisch zu sein. Denn demokratische Politik besteht ja aus Regierung und Opposition, die sich aus Prinzip gegenseitig misstrauen müssen, um gegeneinander arbeiten zu können. Jede Regierung, die Expertise heranzieht, steht aus Sicht der Opposition im Verdacht, diese Expertise so ausgewählt zu haben, dass sie zu den eigenen Entscheidungen passt.
SH: Das heißt, weil Politik antagonistisch ist, muss Expertise zu Politisierung führen?
NK: Zumindest kann Expertise davon nicht völlig frei sein. Zum einen wird Expertise immer im Hinblick auf Entscheidungen abgefragt. Wenn das in einem politischen Konflikt stattfindet, verstärkt sich die Politisierung. Aus
SH: Dennoch scheint heute – Stichwort: „alternative Fakten“ und Verschwörungstheorien – die Politisierung von Wissen anders und auch destruktiver zu sein als in den 1980er Jahren.
NK: Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts ändert sich etwas, das während der Covid-Pandemie, aber zum Teil schon früher in der sogenannten Technokratie-Debatte diskutiert wurde.
SH: Der Soziologe Alexander Bogner hat jüngst kritisiert, dass wir es heute mit einer „Epistemisierung des Politischen“ zu tun haben.
NK: Die Gesellschaft beobachtet sich heute vor allem durch Wissenskategorien. Deshalb ist sie so anfällig für das, was Alexander Bogner beschreibt, nämlich, dass sich die Politik in unredlicher Weise hinter der Wissenschaft versteckt: Sie tut dann so, als ob ihre Entscheidungen in Wirklichkeit keine Entscheidungen sind, sondern von der Wissenschaft soweit gedeckt, dass sie gewissermaßen „alternativlos“, also eben gerade keine Entscheidungen mehr sind. Wer dem dann widerspricht, muss „besseres Wissen“ beibringen, aus dem sich dann wiederum seine Sicht der Dinge ableiten lässt – und alle diejenigen, die keine Expertise zu ihrer Meinung finden, sind dann vom politischen Spiel ausgeschlossen. Man muss aber sagen, dass sich diese Prominenz des Wissens ein Stück weit überhaupt nicht vermeiden lässt, vor allem, wenn wir in einer sog. Wissensgesellschaft leben wollen:
Der Experte muss sich auch politisch beweisen, denn Öffentlichkeit ist Teil des politischen Systems. Die Talkshow ist nichts anderes als das verlängerte Parlament.
SH: Sie sprechen einerseits von der Politik, andererseits vom Wissen. Den meisten Menschen begegnet beides vermittelt über Medien. Welche Rolle spielen sie in diesem Gefüge?
NK: Seit man historisch eine funktionale Ausdifferenzierung von Politik und Wissenschaft und damit auch die Genese von Expertise beobachten kann, ist diese massenmedial vermittelt. Das Äquivalent vor der Ausdifferenzierung wäre der Berater am Hofe, der direkt mit dem Herrscher spricht, was aber eine Reihe ganz anderer Probleme zur Folge hat. Heute sind Wissenschaft und Politik zwar in der Expertise gekoppelt, aber gegeneinander ausdifferenziert und der Berater steht nicht die ganze Zeit neben dem König, sondern kann unabhängig davon zu einem Publikum reden, in dem der ‚König‘ nur eine – und in vielen Fällen nicht die bedeutendste – Adresse ist.
Gleichzeitig sind alle Medien selektiv, nicht nur Tele- oder Massenmedien, die für die Darstellung von Expertise sehr beliebt sind. Massenmediale Expertise ist vor allem wichtig, um die Legitimität politischer Entscheidungen vor dem Publikum zu überprüfen. Man lässt bei Markus Lanz also nicht nur Politiker darüber streiten, was der richtige Weg ist, wobei das ja auch oft eine Inszenierung aus Regierung und Opposition ist. Üblicherweise holt man einen Wissenschaftler oder einen Journalisten hinzu, der wie eine Art Erdung der Diskussion wirkt. Eine jüngere Entwicklung ist, dass einzelne Wissenschaftler zu prominenten Personen geworden sind, übrigens nicht nur in Deutschland. Fast jedes Land hatte während der Pandemie seinen Christian Drosten. Die Kritik der Epistemisierung von Politik ist auch deswegen so plausibel, weil uns diese Pandemieexpertise so präsent ist. In dieser Konstellation kommt dann der Verdacht auf: Der wird hingestellt, um die Politik zu rechtfertigen. In der Pandemie hat das auch durchaus Sinn ergeben, denn es war ja auch so: Man wollte die Prominenz von Wissenschaft nutzbar machen um der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass die politischen Entscheidungen richtig und notwendig sind. Insofern wurde die Expertenfigur ganz offensiv platziert. In dieser Prominenz ist das bei kaum einem anderen Themenfeld vorher oder nachher so zu beobachten.
Mittlerweile sitzen auch immer mehr Wissenschaftler in den Talkshows und reden ganz aktiv mit. Sie „faktchecken“ die Politik, aber auch sich gegenseitig. Hier entsteht nun aber eine Tücke: Experten braucht man als Wissende nur dann, wenn man die jeweilige Problemstellung nicht selbst beurteilen kann. Wenn ich aber selber genau weiß, was richtig und was falsch ist, dann macht Expertise keinen Sinn. Um Expertise sinnvoll zu nutzen, muss ich also Vertrauen aufbringen, dass jemand anderes mir sagt, was der Fall ist. Wenn aber die ganze Zeit der Verdacht artikuliert wird, bei vielen handele es sich gar nicht ‚wirklich‘ um Experten, so dass die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird, wie Expertise inszeniert wird, dann wird dieses Vertrauen problematisch. Und problematisches Vertrauen funktioniert nicht.
SH: Schaut man die Sendung von Markus Lanz, hat man oft das Gefühl, der Moderator weiß eigentlich schon, was die Experten sagen.
NK: Das ist ein gutes Beispiel für einen Inszenierungseffekt. Man sieht hier das Problem der „strukturellen Kopplung“: Lanz muss das Vertrauen aufbringen, dass der Experte echt ist, um ihn erstens für die mediale Inszenierung einspannen zu können, und zweitens, um zum Urteil zu kommen, dass beispielsweise sein Buch es wert ist gelesen zu werden. Lanz weiß aber besser als der Experte, wie das massenmedial aufbereitet wird. Alles, was in der Sendung passiert, fällt in seinen Kompetenzbereich. Idealerweise wählt man Experten nach wissenschaftlichen Meriten aus. Aber weil zu dieser Übersetzungsleistung ins Politische noch ganz andere Fähigkeiten gehören, wird man immer auch fragen: Wer ist in der Lage, einfache Sätze zu formulieren? Wer hat die Kompetenz, Entscheidungsszenarien abzuleiten?
Der Experte muss sich also auch politisch beweisen, denn Öffentlichkeit ist Teil des politischen Systems.
Politische Entscheidungen sind rein wissensmäßig nicht einzufangen.
SH: In Ihrem Buch Alternative Fakten. Zur Praxis der kommunikativen Erkenntnisverweigerung haben Sie die Infragestellung ausgewählter Experten durch Teile der Bevölkerung, aber auch den öffentlich ausgetragenen Streit zwischen verschiedenen Virologen beschrieben. In dem Maße, wie die Pandemie durch die derzeitigen militärischen Krisen abgelöst wurde, hat auch die Sicherheitsexpertise die Virologie aus der Öffentlichkeit verdrängt. Wird Wissen über die internationale Politik und ihre Konflikte im politischen Raum anders verarbeitet?
NK: Der wichtigste Unterschied scheint mir zu sein, dass uns das Virus nicht zuhört. Es gehört bei einer Pandemie nicht zum Wesen des Gegenstands, dass sich das Objekt des politischen Handelns reflexiv verhält, also permanent auf die Kommunikation über Regulierung reagiert. Hat man mit einem militärischen Konflikt zu tun, gibt es demgegenüber das Problem, dass der Transparenz sehr strenge Grenzen gesetzt sind. Ernsthafte sicherheitspolitische Expertise fällt also ein gutes Stück weit in den Bereich des Staatsgeheimnisses, wenn sie sich nicht obsolet machen will.
Nun ist Deutschland in den Konflikten, die Sie ansprechen, völkerrechtlich nicht unmittelbar Kriegspartei. Das heißt, die Öffentlichkeit agiert nicht getreu dem Motto: Es ist legitim, bestimmte Informationen nicht preiszugeben. Das wäre vermutlich anders, wenn Deutschland offen am Krieg beteiligt wäre. Denn Krieg ist das „Entdifferenzierungsereignis“ schlechthin.
Im Gegensatz zur Situation während der Pandemie, als Expertise immer wieder Anstöße zur Debatte geliefert hat, hat man vor dem Hintergrund des Krieges wahrscheinlich auch deshalb viel stärker das Gefühl, dass Experten selber schon als Politiker in die Diskussion gehen. Ein wichtiges Mittel der Auseinandersetzung ist dann, sich gegenseitig die Expertise abzusprechen. Das ist gar nicht notwendigerweise illegitim, es ist vielmehr der Talkshow-Konstellation geschuldet, denn die eigene Expertise muss da eben mit politischen Mitteln behauptet werden. Im Kern bedeutet das, den Gegner zu delegitimieren, indem man entweder seine wissenschaftlichen Meriten oder seine Moral in Frage stellt.
SH: In Ihrem Buch kritisieren Sie jedoch, dass sich durch das gegenseitige Absprechen der Expertise der Fokus vom eigentlichen politischen Gegenstand wegverlagert.
NK: Mein Buch sagt zunächst, dass diese Ablenkung stattfindet. Ob das funktional oder dysfunktional ist, und vor allem wofür, das muss man immer am konkreten Fall analysieren. Es gibt durchaus Konflikte, die man politisch gar nicht beilegen kann. In diesem Fall kann die Verschiebung aufs Epistemische ein Weg sein, damit umzugehen: Statt vor der Unlösbarkeit des Problems zu verzweifeln, wendet man die Frage hin und her, welches Problem man eigentlich hat. Will man diese Verschiebung kritisieren, dann reicht es also nicht, die Verwissenschaftlichung in den Blick zu nehmen. Stattdessen müsste politischer – und eben nicht wissenschaftlicher – Widerspruch angemeldet werden. Man müsste dann sagen, dass es doch gar nicht auf das Wissen ankommt, sondern aus diesen und jenen Gründen politischer Dissens besteht. Alles andere ist eine Art Destabilisierungskritik oder „Trotzkonstruktivismus“: Wissenschaftler kritisieren, dass auf andere Wissenschaftler gehört wird. Sich selbst gibt man aber nicht die Blöße und meidet das politische Terrain. Aus Sicht der Wissenschaftler ist das verständlich, aber es stößt eben schnell an die Grenze, an der es als Verdacht auf die ganze Wissenschaft abfärbt.
Im Fall der Sicherheits- oder Militärexpertise ist es ja nicht so, dass sich der politische Streit hinter dem Wissen verstecken würde, sondern es ist für alle Beteiligten offensichtlich, dass das, was als Wissensstreit geführt wird, ein politischer Konflikt ist. Das ist auch der Unterschied zur Pandemie, als teilweise wirklich Verschiebungen der Konflikte vorgenommen wurden.
SH: In der Osteuropaforschung führen viele die deutsche Außenpolitik gegenüber Russland auf das „fehlende Wissen“ über die Ukraine zurück. Außenpolitik wird also als Wissensfrage verhandelt.
NK: Diese Form der Kritik scheint mir das bisher Gesagte zu bestätigen. Im Hinblick auf die deutsche Russlandpolitik sollten wir zunächst festhalten, dass die überwiegende Zahl ihrer Repräsentanten, außer vielleicht Gerhard Schröder, sagen, dass sie sich geirrt haben. Die Interpretation, zu sagen, sie haben es nicht besser gewusst, kann also direkt an deren Deutung anschließen. Ob sie „es“ wirklich besser gewusst hätten, wenn sie mehr über die Ukraine gewusst hätten, ist hochgradig spekulativ. Politische Abläufe sind so komplex, dass man oft gar nicht so ganz genau weiß, wo man sich eigentlich geirrt hat, wenn man merkt, dass das Ergebnis nicht stimmt. Vor allem die Außenpolitik operiert natürlich ins Nebulöse hinein. Die Feststellung, dass man anders gehandelt hätte, wenn man mehr gewusst hätte, stimmt aus dieser Perspektive immer, wenn einem das Ergebnis nicht passt.
Die eigentliche Frage ist aber, ob man es wirklich hätte besser wissen können. Eine Entscheidung, von der man weiß, dass sie richtig ist, ist keine. Entscheidung bedeutet in der Regel, zwischen Widersprüchen zu wählen. Das hat Konsequenzen. Die Verkettung dieser Konsequenzen kann niemand überblicken und deswegen sind politische Entscheidungen rein wissensmäßig auch nicht einzufangen.
Man muss aber aufpassen, dass sich die Politik nicht hinter der Unmöglichkeit von Wissen versteckt. Falsche Entscheidungen sind natürlich trotzdem möglich und können auch damit zusammenhängen, wem man nicht zugehört hat und für welche Experten man sich entschieden hat. Gleichzeitig muss man der Politik zugestehen, dass sie das, was sie tut, anders kommuniziert, als sie es tut. Und zwar nicht aus Hinterlistigkeit, sondern weil das der Logik des Prozesses geschuldet ist. Auch die Wissenschaft kommuniziert ihre Ergebnisse anders als sie diese in der Forschung prozessiert. Zudem ist es nie „die Wissenschaft“, die kommuniziert, sondern Wissenschaftler. Somit bleibt etwa die Beschwerde, dass irgendein Problem klarerweise darauf zurückzuführen ist, dass seit 20 Jahren niemand auf einen hört, zwar wissenschaftstheoretisch insofern Humbug, als man einfach nicht wissen kann, wie entschieden worden wäre, wenn man es gewusst hätte, kann aber trotzdem ein richtiger Satz sein, weil Politik natürlich auch entscheidet, auf welche Expertise sie wert legt – und sich dementsprechend auch darin irren kann.
Solange wir dabei bleiben, Expertise gegen Expertise zu stellen, bewegen wir uns in einer Schleife.
SH: Sowohl in der Gesellschaft als auch in der Wissenschaft, nicht so sehr jedoch in der Politik selbst, scheint es ein Unbehagen gegenüber politischer Expertise zu geben. Wie kann diese Vermittlung zwischen Politik und Wissenschaft gelingen?
NK: Das Problem ist, dass eine Frage in diesem Gefüge nicht explizit thematisiert wird und deswegen als böser Verdacht die Debatten umtreibt: Wer ordnet Expertise aus politischer Sicht ein? Das ist derzeit ein Prozess, der weitgehend im Verborgenen stattfindet oder über die Selektionskriterien der Massenmedien qua Akklamation geregelt wird.
Die dahinterstehende Frage ist letztendlich, wie weit man es mit der Demokratisierung treiben kann. Es gibt eine Kopplung zwischen Publikum und Politik, die, das haben wir ja besprochen, allerlei Spannung erzeugt. Doch wer oder was kann diese Spannung wie bearbeiten? Klassischerweise waren das unter anderem die Intellektuellen. Die Figur des modernen Intellektuellen wurde Anfang des 20. Jahrhunderts aus einer Krise der Expertise heraus geboren. Exemplarisch lässt sich das anhand der
SH: Befindet sich die Expertise auch heute in der Krise? Und falls ja, wo sind dann die vermittelnden Intellektuellen?
NK: Wir haben ja bereits über das Buch von Alexander Bogner gesprochen. Meine eigene Arbeit gehört sicherlich auch zu einem Teil der Wissenschaft, der sich mit dem Spannungsfeld von Politik und Expertise befasst. Bei allen Unterschieden zwischen unseren Ansätzen muss man aber wahrscheinlich konzedieren: Wir betreiben das immer noch als Formkritik und geben uns nicht die Blöße, selbst eine politische Position zu beziehen. Genau das wäre die Aufgabe von Intellektuellen. Solche Figuren sind aber selten geworden. Zu nennen wäre hier vielleicht noch Jürgen Habermas. Es gibt auch eine Reihe von Leuten, die in die Randbereiche sowohl der Politik als auch der Wissenschaft fallen. Bei diesen Akteuren geht es nicht darum, dass sie immer ein wissenschaftliches Gütesiegel verdienen, sondern dass gesellschaftliche Gruppen ihnen zutrauen, sich zur Expertise aus politischer Sicht zu äußern.
Solange wir dabei bleiben, Expertise gegen Expertise zu stellen oder gar noch die Expertise über die Expertise zu betreiben, bewegen wir uns in einer Schleife. Auf diese Weise kann innerhalb der Politik keine Reflexion über die Auswahl des Wissens stattfinden. Um das zu schaffen, braucht man eine Politisierung des Wissens. Die kann dann immer noch hilfreich oder schädlich sein. Die Figur des Intellektuellen hat aber zumindest das Potenzial, diese Reflexion in das politische System hineinzuholen. Und zwar nicht im Sinne von Auswahlkriterien, sondern im Sinne einer Instanz, die für das Publikum mit dem Publikum reflektiert und dadurch Emanzipation ermöglicht.
SH: Emanzipation ist in diesem Zusammenhang ein großes Wort. Was meinen Sie damit?
NK: Ohne Reflexionsinstanz bleibt das Publikum in der Frage, welchem Experten vertraut werden kann, der einem massenmedial präsentiert wird, im Dunkeln. Entweder steht dann Expertise gegen Expertise und man kann, wie Buridans Esel, gar nicht mehr entscheiden, oder man schluckt, wie es wahrscheinlich die meisten echten Esel machen würden, einfach die Expertise, die einem politisch schmeckt, was eine riskante Herangehensweise ist, wenn sich diese als falsch herausstellt. Wenn man die Entscheidung möglich machen will, muss man das Verhältnis also irgendwie assymmetrisieren: und eine Möglichkeit ist eben das Kerngeschäft der Intellektuellen, nämlich die öffentliche Auseinandersetzung damit, warum welche Expertise wem politisch schmeckt und welche Rückkopplungsschlaufen und Nebenfolgen die Auswahl bestimmter Expertise und politischer Handlungsoptionen so mit sich bringt.
Auf der anderen Seite ist der Intellektuelle eine heroische Figur, deren Heroisierung man nicht ohne weiteres auf den Leim gehen sollte, die in Krisen oft angerufen wird, aber selbst auch ein Krisensymptom ist. Sie schafft eben nur die Möglichkeit, dieses Vermittlungsproblem zwischen Wissenschaft und politischer Öffentlichkeit zu bearbeiten. Lösen tut sie es auch nicht. Es ist ja nicht so, dass Zola kam und dann war die Dreyfus-Affäre vorbei, oder dass Sartre kam und die Franzosen haben sich aus Algerien zurückgezogen. Die Geschichtsschreibung neigt manchmal dazu, den Intellektuellen diese Macht zuzuschreiben, dabei sind sie lediglich die Instanz, durch die das Problem bearbeitet und kommuniziert wurde. Das Problem wird dadurch nicht zwingend kleiner oder verschwindet. Letztendlich ist die Idee vermessen, politische Probleme durch Wissen lösen zu können.
SH: Das klingt ernüchternd. Haben Sie auch eine konstruktive Botschaft?
NK: Nein. Ich verstehe das Unbehagen, aber einerseits glaube ich, dass genau der sanfte, aber bestimmte Druck auf Wissenschaft, etwas für die politische Praxis unmittelbar Anschlussfähiges auszusagen, seinen Teil zur Krise der Expertise beiträgt. Diese Krise besteht ja unter anderem gerade darin, unsichtbar zu machen, dass politische Entscheidungen nicht auf Blaupausen der Wissenschaft zurückgreifen können. Aber vor allem glaube ich, dass die Anerkennung dessen, dass man an einem bestimmten Punkt so nicht weiterkommt, vielleicht der konstruktivste Punkt ist, den sozialwissenschaftliche oder intellektuelle Praxis in Bezug auf genuin politische Probleme machen kann.