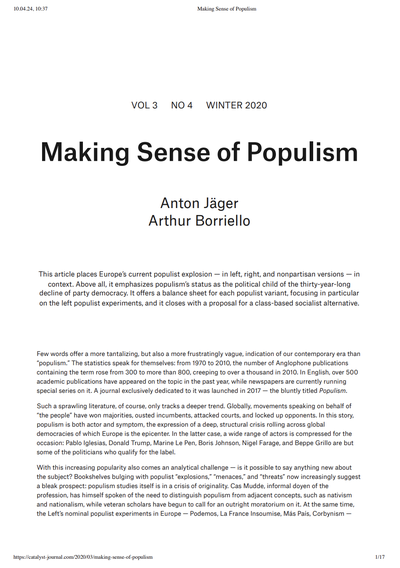Populismus begreifen Borriello und Jäger als eine politische Reaktion auf eine spezifische historische Erfahrung unserer Gegenwart – den Niedergang der vermittelnden Institutionen in den liberalen Demokratien. Darunter verstehen beide sowohl journalistische Medien als auch Parteien, Vereine, Gewerkschaften, Kirchen, Sparkassen. Das heißt, alle Einrichtungen, die zwischen Bürger und Staat stehen und deren Beziehungen regulieren.
Diese Institutionen, so die These, prägten und dominierten das soziale Leben in den westlichen Nachkriegsgesellschaften. Sie stifteten Identität und Zusammenhalt, vertraten die Interessen ihrer Mitglieder nach außen. Wer man war, bestimmte sich in dieser „geordneten Moderne“ durch Mitgliedschaften. Doch ab den 1970er Jahren, schildern Jäger und Boriello, begann dieses Modell zu zerfallen.
Im Zentrum der Argumentation steht dabei die fortschreitende Erosion der Parteienlandschaft. Tatsächlich schrumpften die Mitgliederzahlen der meisten europäischen Parteien seit den 1970er Jahren um mehr als die Hälfte. Die SPD etwa zählte in den 1980er Jahren rund eine Million Mitglieder — heute sind es noch gut 360 000. Ähnliche Verhältnisse herrschen bei der CDU, der FDP und ihren Schwesterparteien in Großbritannien, Frankreich oder Spanien. Parallel zu dieser Entwicklung lässt sich eine sinkende Wahlbeteiligung beobachten. Bei den deutschen Bundestagswahlen etwa von 91,1 Prozent im Jahr 1971 auf 76,4 Prozent im Jahr 2021.
Entpolitisierung und Medialisierung
Durch diese Entwicklungen, argumentieren Jäger und Borriello, sei eine klaffende Lücke zwischen Staaten und ihren Bürgern entstanden. Parteien, die ihre Mitglieder einst aus der breiten Mitte der Gesellschaft rekrutierten und deren Interessen gegenüber dem Staat vertraten, erscheinen aus Sicht der Bürger nun nicht mehr als ihre politischen Vertreter – sondern im Gegenteil als Repräsentanten des Staates. Umgekehrt haben die Parteien mit ihren Mitgliedern auch deren Wissen und politischen Kompass verloren. Während sich Parteiprogramme aus der Sicht von Jäger und Borriello früher aus den Interessen der Mitglieder ergaben, müssen Parteien heute auf Meinungsumfragen zurückgreifen, wenn sie wissen wollen, was in der Bevölkerung vorgeht.
Damit einhergehend beobachten die Politikwissenschaftler seit den 1990er Jahren eine wachsende Kluft zwischen Policy und Politics. Als Policy wird im Englischen die inhaltliche Dimension von Politik bezeichnet — also konkrete Programme und Reformen, beispielsweise in der Wirtschaftspolitik. Politics meint hingegen jenen Aspekt der Politik, bei dem die politische Willens- und Entscheidungsbildung im Vordergrund steht. Hier geht es darum, Koalitionen und Mehrheiten zusammenzubringen, um Policies tatsächlich demokratisch umsetzen zu können.
Während Jäger und Borriello zufolge beide Bereiche in der europäischen Nachkriegsgesellschaft eng miteinander verbunden waren, habe ab den 1990er Jahren eine Verschiebung stattgefunden. Die Policy-Kompetenz habe sich immer mehr in Richtung der Verwaltungen verschoben, beispielsweise der Europäischen Zentralbank oder der Europäischen Kommission. Gewählte Volksvertreter hingegen hätten sich immer mehr auf Politics konzentriert und Politik in die mediale Auseinandersetzung verlagert.
Es handelt sich also um einen zweigleisigen Prozess: Die Parteien entfremden sich von den Bürgern und nationale Regierungen und Parlamente geben gleichzeitig ihre inhaltliche Kompetenz an Beratungsagenturen und technokratische Verwaltungen ab. Kompensatorisch wird dann medial inszenierte Volksnähe gesucht. Zurück bleibt eine Leerstelle zwischen der technokratischen Policy der Verwaltungsorganisationen und einer als hohl empfundenen medialen Auseinandersetzung der gewählten Politik.
Populisten spielen Lückenfüller
Genau hier setzt für Jäger und Borriello die politische Logik des Populismus an. Populistische Bewegungen preschen in die Lücke zwischen Bürger und Staat vor, die durch den Niedergang der gesellschaftlichen Institutionen entstanden ist. In der Bruchstelle agieren sie kommunikativ besonders erfolgreich.
In einem gesellschaftlichen Klima, in dem die vermittelnden Institutionen wegfallen, präsentieren sich Populisten als vermeintlich unmittelbare Repräsentanten des „Volkes“. Das gelingt besonders gut in einem gesellschaftlichen Klima, in dem soziale Zugehörigkeit etwa zu klassen- oder religionsbasierten Gemeinschaften schwindet und traditionelle Akteure nicht mehr als Repräsentanten von sozialen Gruppen fungieren. Hier können Populisten mit Appellen an ein vermeintlich homogenes „Volk“ besonders punkten. Insbesondere gelingt dies auf den sozialen Medien, wo sie die Fiktion einer direkten Verbindung zwischen starken Führerfiguren und ihren Anhängern aufbauen können.
Populistische Bewegungen versuchen also Jäger und Borriello zufolge nicht, verloren gegangene Institutionen und Mechanismen wiederherzustellen – sondern im Gegenteil: den Bruch zu vergrößern und für ihre Zwecke auszunutzen.