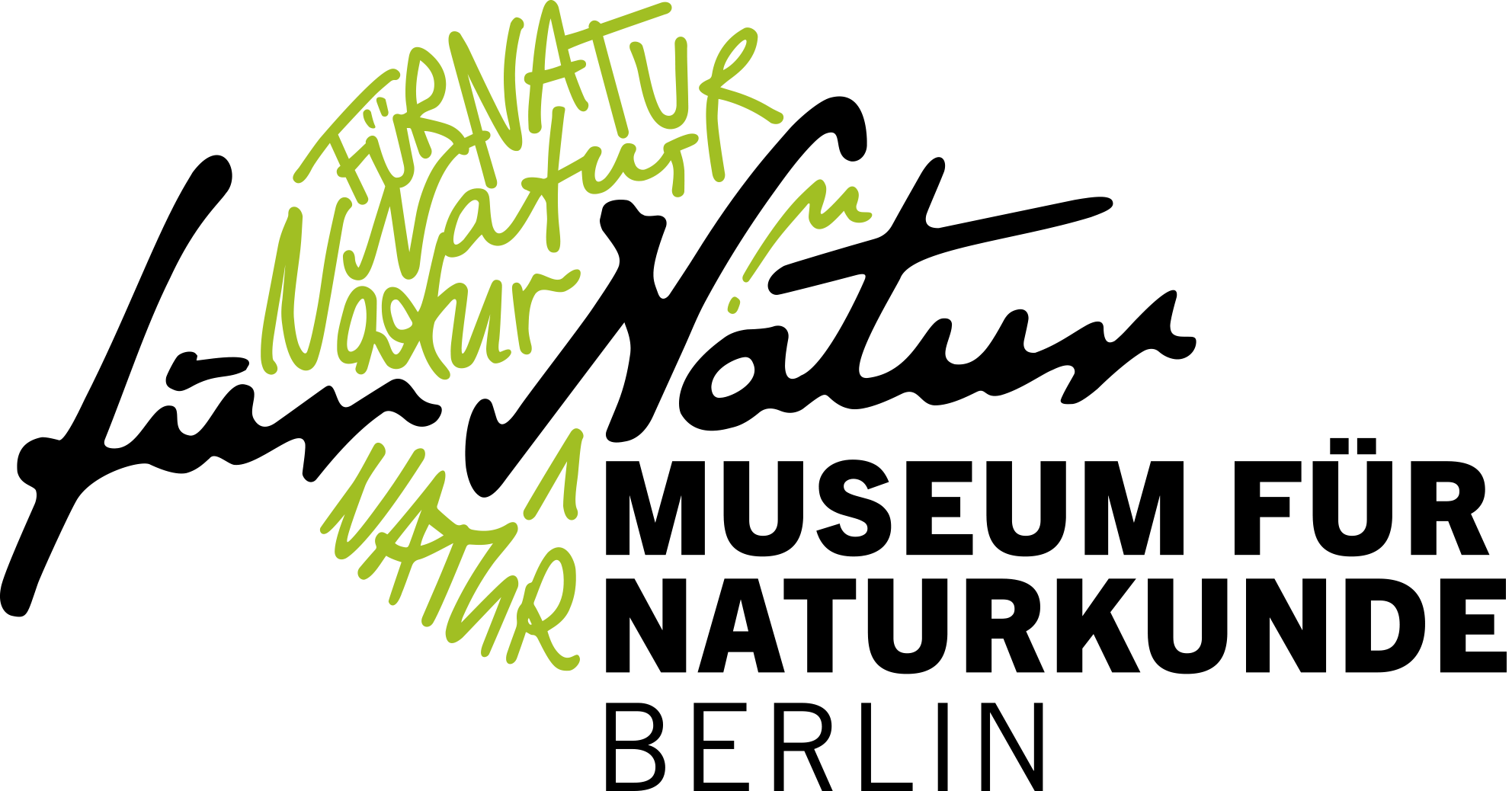Unser psychisches Wohlbefinden hängt eng mit äußeren Umständen zusammen. Nur wenn wir unsere Existenz dauerhaft gesichert sehen, können wir sorgenfrei leben. Die planetare Krise bringt dieses Bild ins Wanken und stellt uns vor nie dagewesene Herausforderungen. Menschen reagieren darauf sehr unterschiedlich. Von grundsätzlichen Klimaleugner*innen zu hochsensiblen Personen, denen der Gedanke an die fortwährende Zerstörung unseres Planeten den Schlaf raubt – jede*r erfährt diese durch den Klimawandel hervorgerufene Unsicherheit und Bedrohung anders und ist unterschiedlich gut in der Lage, sich mit dieser komplexen Thematik auseinanderzusetzen oder sich ihr zu entziehen. Davonlaufen können wir jedoch nicht, denn wir haben keinen zweiten Planeten. Und selbst diejenigen, die nicht an den menschengemachten Klimawandel glauben, werden früher oder später mit der Realität konfrontiert werden. Anhand einer Vielzahl wissenschaftlicher Studien belegt das Positionspapier der DGPPN, dass psychische Krankheiten als direkte und indirekte Folgen des Klimawandels zunehmen.
Direkte Effekte auf die Psyche
Direkt spürbar wirkt sich der Klimawandel über Hitzewellen und Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, Dürren, Stürme und Brände auf die psychische Gesundheit aus. Eine 2021 veröffentlichte Meta-Analyse belegt, dass ein Temperaturanstieg von 1°C das Risiko für psychische Erkrankungen um 0,9 Prozent steigert. Gleichzeitig vergrößern bestehende psychische Erkrankungen das Sterblichkeitsrisiko durch Hitze um das Dreifache.
Studien belegen des Weiteren, dass Luftverschmutzung, zum Beispiel verursacht durch Industrie und Verkehr, unsere kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt. Chemikalien und Feinstaub in der Atemluft haben einen negativen Einfluss auf unsere Konzentration, Rechenleistung, unser Gedächtnis und Leseverständnis.
Durch den Klimawandel kommt es immer häufiger zu Extremwetterereignissen, die für die Betroffenen eine massive psychische Belastung darstellen. Heinz und Kolleg*innen verdeutlichen, dass der Verlust der eigenen Existenzgrundlage oder ein notgedrungener Wohnortwechsel aufgrund einer Naturkatastrophe Stressfaktoren darstellen, welche die psychische Gesundheit oft langfristig beeinträchtigen. So leiden noch ein Jahr nach großen Überschwemmungen bis zu 25 Prozent der Betroffenen an Angsterkrankungen oder Depressionen.
Angst vor der Zukunft
Die existenzielle Bedrohung durch die Klimakrise schafft dabei völlig neue psychische Syndrome wie Klimaangst oder Solastalgie, die Trauer um verlorenen Lebensraum.
Der Begriff Klimaangst fasst negative Emotionen zusammen, die bei einem Menschen durch die Zerstörung der Umwelt hervorgerufen werden können. Wer Klimaangst (engl. climate anxiety) verspürt, geht davon aus, in Zukunft selbst direkt vom Klimawandel betroffen zu sein. Die Ungewissheit darüber, wann und wo dies eintreten wird, führt dabei zu einer zusätzlichen Belastung. Zukunftssorgen, Angst, Trauer, Wut, aber auch Schuldgefühle und Hoffnungslosigkeit treten nicht nur bei psychisch Erkrankten oder direkt von Naturkatastrophen betroffenen Menschen auf, sondern sind laut DGPPN auch in der allgemeinen Bevölkerung weit verbreitet.
Eine kürzlich veröffentlichte Umfrage unter Psychotherapeuten ergab, dass sich vor allem junge Menschen zwischen 19 und 34 Jahren Sorgen wegen der Klimakrise machen, teilweise verbunden mit schweren funktionellen Einschränkungen. So kann die empfundene Überforderung und Hilflosigkeit dazu führen, dass die Betroffenen Schwierigkeiten haben, ihren Alltag normal zu bewältigen. Andere wiederum reagieren mit Verdrängung oder legen einen aufopfernden Aktivismus an den Tag. Die Klimaangst, von der viele junge Erwachsene heute betroffen sind, wurde von der Sozialwissenschaftlerin Renee Lertzman mit der Angst der Babyboomer vor der atomaren Vernichtung im Kalten Krieg verglichen. Doch auch ältere Menschen sorgen sich wegen des Klimawandels. Die Deutsche Alterssurvey ergab, dass ein Viertel der über 43-Jährigen in Deutschland die Bedrohung durch den Klimawandel als hoch einschätzt. Die Teilnehmenden dieser Umfrage sollten die empfundene Bedrohung durch den Klimawandel auf einer Skala von 1 (keine Bedrohung) bis 10 (extreme Bedrohung) angeben. Unter den 43- bis 55-Jährigen lag der Mittelwert bei 5,86, bei den 76-90-Jährigen lag er bei 5,62.
Der Begriff Solastalgie geht auf den australischen Umweltphilosophen
Während Klimaangst sich also auf das, was noch kommen könnte, bezieht, ist die Solastalgie eine Form von seelischem Schmerz angesichts bereits stattgefundener Veränderungen oder Verluste. Da beides relativ neue psychiatrische Erscheinungsbilder sind, gab etwa die Hälfte der in der oben genannten Umfrage befragten Psychotherapeuten an, dass sie sich konkretere Anweisungen wünschen, wie mit derartigen Problemen in der Therapie umzugehen ist. Gleichzeitig jedoch vermerkten circa 80 Prozent von ihnen, dass ihre jetzigen therapeutischen Fähigkeiten sie ausreichend vorbereiten würden.
Indirekte Effekte auf die Psyche
Neben den unmittelbaren Effekten der Klimakrise auf unsere mentale Gesundheit gibt es auch eine Reihe von Faktoren, die sich eher indirekt auf unsere Psyche auswirken. Nahrungsknappheit und eine Verringerung des Nährstoffgehalts von Pflanzen aufgrund von Dürren oder dem Verlust von landwirtschaftlichen Nutzflächen können Mangelerscheinungen hervorrufen, die sich in psychischen Symptomen wie
Nahrungsmittel- und Trinkwasserknappheit kann darüber hinaus zu Konflikten und Kriegen führen und somit zu klimawandelbedingten Fluchtbewegungen. Sowohl die Flucht selbst als auch der Verlust des sozialen Netzwerks sind Risikofaktoren für Angststörungen und
Neue Behandlungsangebote benötigt
Die Forschung zeigt, dass der Klimawandel neue Belastungen für den Menschen mit sich bringt und das Risiko für psychische Erkrankungen erhöht. Laut Meyer-Lindenberg sollte aber nicht vergessen werden, dass es ja durchaus normal sei, eine gewisse Angst im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu verspüren, ohne dass man direkt eine krankhafte Störung hat. Diese tritt erst dann auf, wenn deswegen der Alltag nicht mehr bewältigt werden kann. Dennoch sieht die DGPPN in Zukunft einen steigenden Versorgungsbedarf in der Psychiatrie, vor allem bei Traumafolgestörungen, Angsterkrankungen und Depressionen. Dies könnte den bereits bestehenden Mangel an Therapieplätzen in Deutschland weiter verschärfen. Da es voraussichtlich zu einer Zunahme der klimabedingten Migration kommen wird, müssen die Behandlungsangebote darüber hinaus auch für Menschen aus dem Ausland zugänglich sein.
Um den steigenden Bedarf an psychiatrischer Versorgung zu bedienen, sind ein effizientes Versorgungssystem und eine frühe Intervention laut den Autor*innen des Positionspapiers entscheidend. Der Fokus sollte hierbei auf der Prävention klimabedingter psychischer Erkrankungen und der Deckung wesentlicher Lebensbedürfnisse liegen. Abschließend betont Meyer-Lindenberg, dass auch das eigene Engagement und der Versuch, gesundheits- und klimabewusstes Verhalten bei anderen anzuregen, gegen Klimaangst helfen können.