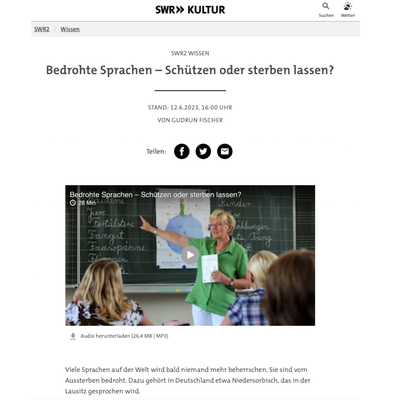Je kleiner eine Sprache, desto gefährdeter ihr Dasein. Gerade, wenn sie sich ihr Gebiet mit anderen, mächtigeren Sprachen teilen muss. So sind in Europa beispielsweise das Sizilianische, Irische, Jiddische und Niederdeutsche gefährdet. Weltweit betrachtet könnten von den heutigen etwa 7000 Sprachen bis Ende des Jahrhunderts rund 3000 aussterben – eine alarmierende Vorstellung, die das Max-Planck-Institut für Anthropologie in Leipzig sogar auf lediglich 100 verbleibende Sprachen im Jahr 2200 zuspitzt. Ob eine Sprache überleben kann, hängt von vielen Faktoren ab, die die Radiojournalistin Gudrun Fischer in ihrer Radioreportage anhand ihrer zwei Lebenswelten Deutschland und Brasilien beleuchtet.
Die Orte könnten unterschiedlicher nicht sein – und doch haben sie etwas gemein: Ihre Minderheitensprachen werden verdrängt. Brasilien, mit seiner bereits 500 Jahre andauernden Kolonialgeschichte, wartet heute mit ganzen 274 indigenen Sprachen auf. Bevor Ende des 15. Jahrhunderts die Portugiesen kamen, waren es jedoch über 1000 – und bis heute nimmt die Anzahl der aktiven Sprecher*innen stetig ab. In Deutschland gibt es dagegen sieben anerkannte Minderheitensprachen und insgesamt etwa 90 weitere, die keinen offiziellen Schutz genießen.
Im Saterland bei Oldenburg sprechen beispielsweise noch etwa 2000 Menschen den letzten Nachfahren des Alt-Ostfriesischen: Seeltersk, oder Saterfriesisch. In dem einst von Mooren umschlossenen Gebiet konnte sich die Sprache bis heute am Leben halten. Doch nur noch für die ältere Generation ist es die Alltagssprache, wie Fischers Gesprächspartner*innen verdeutlichen: Die Jüngeren wechseln für immer mehr Themen zum viel besser ausgebauten Hochdeutsch, das die nötigen Begriffe für die moderne Arbeits- und Lebenswelt bietet. Auch einen Pflichtunterricht zum Erhalt der Sprache gebe es bisher nicht, nur ehrenamtliche Bemühungen. Die Zukunft des Saterfriesischen ist ungewiss.
In Brasilien liegen die Dinge ähnlich: Besonders die neuen Generationen bahnen sich portugiesischsprechend den Weg vom Land in größere Städte, studieren und kommen nicht wieder. Mehr als ein Drittel der indigenen Bevölkerung lebt urban. Doch neben der sozioökonomischen Verdrängung haben die indigenen Gemeinschaften auch mit Verfolgung, Gewalt und neuen Krankheiten zu kämpfen. Eine Situation, die sich unter Bolsonaro deutlich verschärfte. Auch die Verwaltung machte lange Probleme. So erkannten Standesämter beispielsweise indigene Namen oft nicht an, während sie prestigeträchtige – weil westliche – Namen wie Michaeljackson durchwinkten. Die Repressionen haben im Vokabular ihre Spuren hinterlassen – oft sei ein Großteil des Wortschatzes verloren, erklärt die indigene Abgeordnete und Doktorandin Célia Xacriabá. Kein Wunder also, wenn sich Menschen zum Überleben von ihren Sprachen abwenden.
Doch Gudrun Fischer besucht in ihrer Radioreportage auch Orte in Brasilien, an denen indigene Völker ihre Sprache erhalten haben. Sie berichtet von einem Kampf um den Spracherhalt, der mit viel Freude einhergeht: Sprachfestivals, Kneipenabende, Konzerte und die Wiederbelebung alter Erzählungen sollen die Bindung zur eigenen Sprache und den alten Worten wiederherstellen. Dafür betreiben die Gemeinschaften auch eigene Schulen. Den Unterricht halten sie in der eigenen Sprache – und manchmal notdürftig in einer Hütte, wenn die versprochenen Schulgebäude aufgrund mangelnder Gelder unfertig bleiben. Ob sich diese selbstorganisierte Bildung in einer globalisierten Ökonomie behaupten kann, ist ungewiss.
Brasilien, Deutschland und viele weitere Regionen der Welt befinden sich in einer Ära des sprachlichen Umbruchs: Viele Sprachen sind bereits ausgestorben oder davon bedroht, während hier wie dort ein Interesse am Erhalt zu erwachen scheint. Auch die Forschung beschäftigt sich heute vermehrt mit der Bedeutung von Mehrsprachigkeit für das Zusammenleben verschiedener Gesellschaften. Doch während beispielsweise an der Universität Oldenburg die niederdeutsche Germanistin Heike Schoormann über ihre Sprache (und eher noch die Sprache ihrer Eltern) lehrt – und in Radioreportagen wie dieser darüber spricht – sind es häufig nicht-indigene Menschen, die sich mit den amazonischen Sprachen beschäftigen.
Die Linguistin Marília Facó will dies zumindest ändern und leitet besondere Linguistik-Kurse für Indigene. Die Ausbildung solle neben dem Schatz an zeitgenössischen Dokumentationen auch eine Form von Stolz über die Komplexität der eigenen Sprachen vermitteln, erklärt Facó im O-Ton – auch wenn sie als Lehrende selbst keine indigene Sprache spricht. Christel Stolz, Linguistin an der Uni Bremen, betont gegenüber Fischer, dass gerade die vergängliche Natur des gesprochenen Wortes es so schützenswert macht: Wir können keine Vokabeln ins Museum stellen. Verschwinden sie, verschwinde auch das Wissen, das sie über Pflanzen, Mythen und die Kulturgeschichte einer Gemeinschaft tragen. Auch bestehe eine enge Verbindung zwischen der Sprache und der musikalischen Tradition einer Gruppe. Deshalb sei es an den Familien, die Sprachen zu sichern und weiterzugeben. Das Erbe ist riesig, denn weltweit ist Mehrsprachigkeit der Normalfall. Noch.
Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Textes wurde Heike Schoormann als Saterfriesin bezeichnet. Wir haben den Fehler korrigiert.