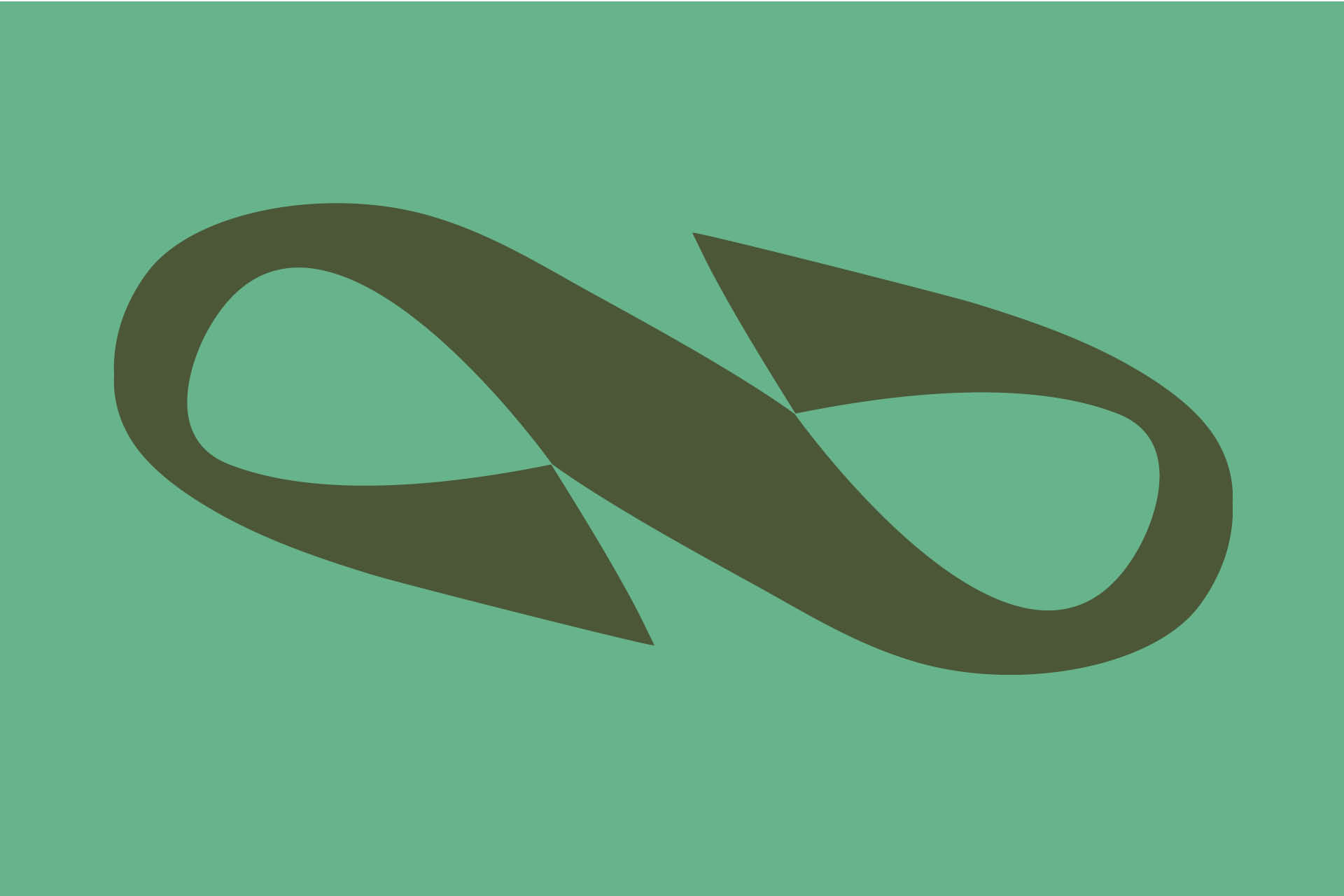Die Fragen stellte Eva von Grafenstein, Redakteurin des Kanals „Planetare Gesundheit“.
Manche Leute befürchten, dass ihre Freiheit durch die Klimakrise zunehmend eingeschränkt wird, zum Beispiel dadurch, dass sie der Umwelt zuliebe weniger fliegen, konsumieren und Fleisch essen sollen. Welches Freiheitsverständnis liegt dieser Befürchtung zugrunde?
Eines, das in der Vergangenheit öfter „negative Freiheit“ genannt wurde. Sie bezeichnet das Freisein von allen möglichen Beschränkungen und strebt vor allem die Maximierung von Handlungsoptionen an. Das bedeutet, je mehr Optionen ich habe, desto besser lebt es sich für mich. Ich bezeichne dieses Freiheitsverständnis als „quantitative Freiheit“, weil es um das Motto kreist: „Je mehr, desto besser“. Wenn man von dieser Logik ausgeht und sagt, ich bin ein optionenmaximierender Akteur oder eine optionenmaximierende Akteurin, dann bedeutet eine Besteuerung von Flugbenzin, ein Verbot von Inlandsflügen, ein Verzicht auf Fleischkonsum, eine Verteuerung der Nutzung fossiler Brennstoffe, ein Tempolimit auf Autobahnen oder eine Umgestaltung des Verkehrs in Richtung öffentlicher Nahverkehr in der Tat, dass ich weniger Wahlmöglichkeiten habe als vorher.
Eine Unterstellung dieses Freiheitsverständnisses ist zudem, dass – wo immer Wahlmöglichkeiten reduziert werden – mir ein Angebot zum Ausgleich gemacht werden muss. Denken wir an den Straßenverkehr, in dem nicht jeder überall und auf jede Weise fahren kann, wie er will. Die Leute, die eine Option aufgeben, beispielsweise bei Rot über die Ampel zu fahren, wollen davon einen Nutzen haben. Weil sie nicht bei Rot über die Ampel fahren, die anderen aber auch nicht, kommen sie konfliktärmer oder lebendig zum Ziel. Hier wird also eine Kosten-Nutzen-Rechnung angestellt.
Finden Sie dieses Freiheitsverständnis problematisch?
Es gibt bei diesem Freiheitsverständnis eine eingebaute Blickverkrümmung, die nah über fern und kurz über lang wertet. Wenn ich mich und meinen tatsächlichen unmittelbaren Nutzen an erste Stelle setze, dann sind Nahverhältnisse natürlich wichtiger als Fernverhältnisse und kurzfristige Interessen wichtiger als langfristige. Auf die Belange von Menschen, die mir nutzen oder schaden können, werde ich mehr Rücksicht nehmen als auf die Belange von Menschen, die dies nicht können – etwa von Menschen, die sehr weit weg wohnen oder noch nicht geboren wurden. Dies geschieht zum Beispiel, wenn wir sehen, dass diejenigen, die unter der Erderwärmung am meisten leiden, diejenigen sind, die am wenigsten dazu beigetragen haben, und dass Innovations- und Transformationslasten auf die Zukunft verschoben werden.
In Ihrem Buch Qualitative Freiheit: Selbstbestimmung in weltbürgerlicher Verantwortung schreiben Sie, dass Sie den akademischen Diskurs über Freiheit neu ausrichten möchten. Was meinen Sie damit?
Ich möchte den Fokus auf einen Freiheitsbegriff legen, der nicht darin besteht, möglichst viele, sondern möglichst gute Optionen zu haben. Deswegen schlage ich das Konzept der „qualitativen Freiheit“ vor. Auf die Kurzformel gebracht geht es bei ihr um das Motto: „Je besser, desto mehr“. Das heißt, je besser eine bestimmte Option ist, desto mehr sollten wir sie schützen, stärken und fördern.
Ich möchte den Fokus auf einen Freiheitsbegriff legen, der nicht darin besteht, möglichst viele, sondern möglichst gute Optionen zu haben.
Bei der Freiheit kommt es uns immer schon auf die Qualität der Optionen an. Dass wir beispielsweise im Straßenverkehr alle Teilnehmenden davon abhalten, auf der linken Fahrbahn einer Landstraße zu fahren, ist eine massive quantitative Freiheitseinschränkung. Sie betrifft jeden, der auf Landstraßen am Straßenverkehr teilnimmt, was fast alle Bundesbürger sind. Mit dieser Freiheitseinschränkung gehen die meisten relativ entspannt um, nehmen sie vielleicht nicht einmal als solche wahr. Stellen wir ihr nun eine vergleichbare Freiheitseinschränkung gegenüber und sagen, dass wir – um Konflikte zu vermeiden – das politische Spektrum ähnlich einschränken und die Äußerung linker Meinungen verbieten. Dann wären etliche Leute wahrscheinlich weniger beschränkt als durch Einschränkungen im Straßenverkehr, weil die meisten häufiger am Straßenverkehr als an politischen Diskussionen teilnehmen und politisch eher nicht links einzuordnen sind. Aber es würde hoffentlich der Aufschrei „Das geht ja nun gar nicht!“ durch die Bevölkerung gehen. Doch was ist im zweiten Beispiel anders? Es ist ganz klar die Art und Güte der Option. Die Meinungsäußerungsfreiheit ist für uns ein weit höheres Gut als die physische Bewegungsfreiheit im Verkehr.
Woran lässt sich die Qualität von Freiheit festmachen?
Der Vorteil der qualitativen Freiheit ist, dass sie zwar besagt, dass es auf eine Qualität ankommt, nicht aber, auf welche. Hier unterscheide ich zwischen der abstrakt allgemeinen Idee von Freiheit und ihren vielen konkreten Konzepten. Es kann ja durchaus sein, dass Menschen an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was sie schützen und stärken wollen. Das erachte ich innerhalb bestimmter Grenzen für völlig legitim. Ein starker, sachlicher Vorteil der Konzeption qualitativer Freiheit ist, dass man gesellschaftlich aushandeln muss, welche Optionen einem wichtig sind.
Dieser gesellschaftliche Aushandlungsprozess steht uns noch bevor. Er findet idealerweise durch Partizipation statt, also dadurch, dass die Leute selber artikulieren, was sie unter einem freien Leben verstehen. Alle potenziell Betroffenen sollten idealerweise zu Beteiligten gemacht werden. Wo Partizipation unmöglich ist, müssen wir Repräsentation anstreben. Natürlich können wir nachfolgende Generationen nicht direkt beteiligen, weil wir mit ihnen nicht reden können. Auch können wir nicht bei jeder Entscheidung des Bundestages die Bewohner und Bewohnerinnen der Südseeinseln einfliegen. Aber wir können uns Gedanken darüber machen, wie wir die Interessen und Rechte entfernt lebender Menschen und zukünftiger Generationen repräsentieren, zum Beispiel über Stellvertreter und Stellvertreterinnen oder Verfassungsklauseln.
Wie kann man argumentativ begründen, dass alle potentiell Betroffenen zu Beteiligten gemacht werden sollten?
Wenn ich den Anspruch geltend mache, dass mir Freiheiten eingeräumt oder sie nicht gewalttätig gestört werden, muss ich diesen Anspruch rechtfertigen. Wie kann ich dies tun? Kann ich meine Rechtfertigung darauf stützen, dass ich blond und blauäugig bin, männlichen Geschlechts, eine bestimmte Steuerklasse habe oder eine bestimmte Konfession? Kann ich sie irgendwie an der Partikularität meiner Existenz festmachen? Das wird nicht funktionieren, weil nicht genug Leute mitgehen werden. Das Argument, das universal zustimmungsfähig ist, lautet: Mir steht Freiheit zu, sofern ich Person bin. Und wenn dies so ist, dann steht sie allen Personen zu. Das gilt auch für Personen, die auf meine Entscheidungen nicht einwirken können, wohl aber von ihr betroffen werden, also beispielsweise weit entfernt lebende Menschen oder die Mitglieder nachfolgender Generationen.
Diesem Anrecht auf Berücksichtigung wird aber oft nicht genügend Rechnung getragen, weil wir im Alltag dazu neigen, kurz über lang, nah über fern und stark über schwach zu gewichten. Insofern ist es bei besonders schutzwürdigen Interessen sinnvoll, Instanzen einzurichten, die prüfen, ob durch die Mehrheitsentscheidungen in einer Demokratie das Prinzip verletzt wird, dass allen Personen gleichermaßen Freiheitsrechte zustehen.
Diesem Anrecht auf Berücksichtigung wird oft nicht genügend Rechnung getragen, weil wir im Alltag dazu neigen, kurz über lang, nah über fern und stark über schwach zu gewichten.
Gibt es solche Instanzen bereits?
Die Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen zum Beispiel versucht seit Jahr und Tag zu erreichen, dass die Rechte zukünftiger Generationen in der Verfassung verankert werden. Das kann über
Wenn der Einzelne auf alle Rücksicht nimmt, führt das nicht zwangsläufig dazu, dass er sich stark einschränken muss?
Wir brauchen einen neuen, positiv besetzten Begriff von Einschränkung, den man am Beispiel des Erlernens eines Musikinstruments deutlich machen kann: Wenn ich ein Musikinstrument spielen lernen möchte, dann schlage ich nicht jede Taste auf jede beliebige Weise an. Dass ich mich einschränke und nur bestimmte Tasten auf eine bestimmte Art drücke, ist konstitutiv dafür, dass ich irgendwann vom Blatt spielen und später vielleicht sogar improvisieren und komponieren kann. Diese künstlerische Freiheit, die ich, sagen wir, nach 15 Jahren Klavierpraxis – also über viel, viel Selbstbeschränkung – erreiche, ist eine qualitativ andere Freiheit als die des bloßen Herumklimperns. Beschränkungen stellen also nicht immer und zwangsläufig Freiheitshindernisse, sondern oftmals den eigentlichen Weg zur Freiheit dar.
Wir müssen außerdem begreifen, dass es unterschiedliche Arten von Schranken gibt. Es besteht ein riesiger Unterschied zwischen einer Schranke, die bestimmte Handlungen zugunsten der ökologischen Lebensfähigkeit zukünftiger Generationen verbietet, und einer Schranke, die allen blonden Menschen das Essen von Eiscreme verwehrt. Was die eine von der anderen Schranke unterscheidet, ist das Vernünftige bei der einen und das Willkürliche bei der anderen. Nicht nur die Qualität der Optionen, sondern auch die der Schranken muss diskutiert werden. Was sind gute, das heißt ermöglichende und freiheitsstärkende Schranken? Dieser so notwendige Diskurs wird blockiert, solange man pauschal alle Beschränkungen als gleichermaßen freiheitswidrig ausgibt.
In Ihrem Buch wollen Sie Impulse für einen moralisch, sozial und ökologisch nachhaltigen Liberalismus geben. Was verstehen Sie darunter?
Es ist mir wichtig, an dieser Stelle nur als Bürger zu sprechen – ein überstimmbarer Bürger von 80 Millionen. In einem nachhaltigen
In einem nachhaltigen Liberalismus wird der Fokus auf Pfadabhängigkeiten gelegt, also darauf, welche langfristigen Konsequenzen bestimmte Handlungen haben.
Umgekehrt gilt: Wenn beispielsweise ein Tempolimit eingeführt und gleichzeitig erklärt wird, wie viele Tonnen CO2 dadurch jährlich eingespart werden, wird deutlich, wie viele Unfreiheiten der heutige Status quo in sich beinhaltet und wie freiheitlich es sein kann, für ökologische Verkehrsbedingungen zu sorgen.
Reicht das aus?
Nein, wir müssen außerdem die ökologischen Wege bequemer, schneller und leichter machen. Wir können und dürfen die Verkehrswende nicht allein der Einsicht und dem guten Willen der Bürgerinnen und Bürger überlassen. Auf dem Weg zur Arbeit, aus Liebe zur Umwelt, stundenlang durch Regen und Schlaglöcher radeln und verschwitzt ankommen, werden nur wenige wollen. Bessere Fahrradwege und ÖPNV-Anbindungen müssen es Durchschnittsbürgern erleichtern, das Richtige zu tun.
Befinden sich Politik und Wirtschaft auf einem guten Weg?
Zum Teil; wobei die Wirtschaft bisweilen schnellfüßiger ist als die Politik. Bei einigen Firmen ist ein proaktives Handeln wahrzunehmen, denen, die nachhaltig handeln, durch entsprechende Produkte und Dienstleistungen entgegenzukommen. Etliche Unternehmen haben erkannt, dass sie damit gutes Geld verdienen. Es gibt hier also einen gewissen Wandel von unten. Im Bestreben, einen sich wandelnden Kundengeschmack zu bedienen, unterbreiten zunehmend mehr Firmen ökologische Angebote.
In der Politik hingegen kann man es sich leisten, nicht unmittelbar auf den Kundengeschmack zu reagieren. Das hat auch sein Gutes. Wenn wir beispielsweise eine fremdenfeindliche Stimmung in der Bevölkerung haben, müssen unsere Politiker und Politikerinnen sie nicht eins zu eins in politische Maßnahmen umsetzen. Zum anderen hat es aber auch etwas Schlechtes, wenn sie sich durch ihre eigenen, veralteten Vorstellungen von Freiheit im Weg stehen und ins politische Abseits befördern.
Wie meinen Sie das?
Lassen Sie mich ein Beispiel aus meiner Forschung geben: In Argentinien gab es lange Zeit die
Wie sähe eine Gesellschaft aus, in der die von Ihnen proklamierte qualitative Freiheit gelebt wird?
Mir scheint, wir dürfen das Nachdenken über Freiheit nicht auf die „Freiheit von“ Einschränkungen, Zwängen und dergleichen beschränken, sondern müssen mehr über die „Freiheit zu“ bestimmten Zwecken und Zielen reden. Weniger ein Liberalismus des Besitzschutzes als einer der Chanceneröffnung, weniger Verteidigung des Erreichten und mehr Eroberung des Neuen, weniger Einigeln, mehr Anpacken. Denn: Wer nicht alle Freiheiten quantitativ gleich gewichtet, muss erklären, warum er oder sie diese Freiheit qualitativ höher als jene veranschlagt, und für diese Entscheidung um Zustimmung werben. Dieser Appell wird in der Regel nur funktionieren, wenn dabei die Freiheit der jeweils anderen, deren Rechte und Interessen, ebenso berücksichtigt wird wie die eigene. Rücksicht nehmen, umsichtig sein, vorausschauend handeln – Besonnenheit, Maß halten, Klugheit –, das alles wird genau dann wichtig, wenn wir neue Wege gehen wollen und dafür die Zustimmung und Mitwirkung anderer benötigen. Kurz: Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die weniger auf den Besitzstand pocht und stattdessen immer wieder aufs Neue erwägt, „welche Freiheiten“ und „wessen Freiheiten“ neu zu schaffen wären.