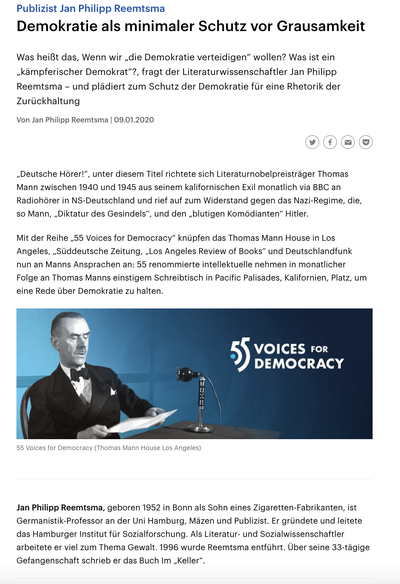Für das Projekt „55 Voices for Democracy“, im Rahmen dessen 55 Intellektuelle ihre Überlegungen zur Demokratie zu Papier gebracht haben, fragt Reemtsma, worum es Menschen gehen sollte, wenn sie mit Worten für die Demokratie streiten. Kurz: Wie lässt sich rhetorisch für die demokratische Grundordnung eintreten, ohne ihr trotz bester Intentionen letztlich zu schaden?
Um dies beantworten zu können, so Reemtsma, muss nach dem Zweck der Demokratie gefragt werden. Auf die demokratische Ordnung könnten vielerlei ehrgeizige Ziele projiziert werden, etwa, dass sie Gesellschaften bunter machen oder dass sie die persönliche Entfaltung ihrer Bürger*innen fördern soll. Das alles, so Reemtsma, sei ohne Zweifel wünschenswert, es verfehle aber den Kern dessen, worum es in Demokratien gehe. Im Zentrum der demokratischen Grundordnung stünden, so argumentiert Reemtsma mit der politischen Theoretikerin
Dass wir uns gegenseitig nicht das Schlimmste antun – also etwa Gewalt oder Folter –, werde in modernen Demokratien durch verschiedene Einrichtungen und Prozesse sicherzustellen versucht. Hierzu zählen unter anderem garantierte Grundrechte für jede*n , eine unabhängige Rechtsprechung, freie Medien und ein System der „
Wird nun von der Verteidigung der Demokratie gesprochen, dann kann es für Reemtsma nur darum gehen, diesen Kern zu schützen. Anders ausgedrückt: Nur dort, wo wir als demokratische Gesellschaft Gefahr laufen, uns und einander nicht mehr erfolgreich vor dem Schlimmsten schützen zu können, ist die Demokratie wirklich bedroht. Und nur dort, so lässt sich ergänzen, sollten diejenigen, die für jene Bedrohung verantwortlich zu machen sind, auch als „Feinde der Demokratie“ bezeichnet werden – statt sie lediglich als Menschen mit anderen Präferenzen zu sehen oder abweichenden Vorstellungen darüber, was ein gutes Leben ausmacht.
Reemtsmas Plädoyer für weniger Pathos und mehr rhetorische Zurückhaltung findet sich in ähnlicher Form bei Philip Manow. Der Politikwissenschaftler spricht von einer „Demokratiegefährdung durch Demokratiegefährdungsdiskurse“
Debatten über die Demokratie und deren Bedrohung zeichnen sich allerdings durch ein besonderes Charakteristikum aus, das paradoxerweise eines der grundlegenden demokratischen Prinzipien – das der politischen Gleichheit – untergräbt. Denn mit „Gegnern der Demokratie“, so Manow, „kann es keine Gemeinsamkeiten geben“. Damit fällt dann aber genau diejenige Voraussetzung weg, die Bedingung dafür ist, dass die „Demokratie als Verfahren friedlichen, regelgebundenen Zusammenlebens“
Ein zentrales Ergebnis dieser Überlegung ist für Manow, „dass man diejenigen, denen es wirklich ernst ist, daran erkennt, dass sie mit Demokratiegefährdungsdiskursen zurückhaltend umgehen.“
Weder Reemtsma noch Manow bestreiten, dass Demokratien konstitutiv gefährdet sind – im Gegenteil. Manow erklärt die Unsicherheit zu einem Wesensmerkmal der Demokratie und Reemtsma fasst die Möglichkeit, dass sich Menschen (abermals) auch das Schlimmste antun könnten, explizit ins Auge. Beide fordern aber, sich Rechenschaft darüber abzulegen, wann es angemessen ist, von einer tatsächlichen Gefährdung der demokratischen Ordnung zu sprechen.
Mit dem Erstarken der AfD und drei anstehenden Landtagswahlen, bei denen die Partei möglicherweise neue Rekordergebnisse erzielen könnte, mag man bei diesen Ausführungen vor allem den Umgang mit dem parteipolitisch organisierten Rechtspopulismus vor Augen haben. Allerdings schärfen sie den Blick auch für den zivilgesellschaftlichen Diskurs. Seien es die PEGIDA-Versammlungen, die Bauernproteste oder die Agitationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen: Auf vielen Großdemonstrationen der vergangenen Jahre waren Galgen zu sehen oder die Rede von „Volksverrätern“ zu hören. Immer wieder wurde suggeriert, dass Politik gegen „das Volk“ gemacht werde – und damit gegen das demokratische Prinzip, demgemäß die Souveränität eben beim Volke liegt.
Ebenfalls bedenklich ist es allerdings, wenn Vertreter*innen konservativer Parteien aus dem demokratischen Spektrum rhetorisch von Demonstrationen gegen Extremismus ausgegrenzt werden, weil deren Organisator*innen „gar keinen Bock auf Rechte jeglicher Couleur“ haben. Das war Ende Januar in München der Fall, als die Versammlungsleiterin eines Protestes gegen Rechtsextremismus Politiker*innen der CSU zu ungebetenen Gästen erklärte
In beiden Fällen werden unter Rückgriff auf die Demokratiegefährdungsthese aus politisch Andersdenkende politische Feinde, mit denen es dann eben keine Gemeinsamkeiten geben kann. „Außerhalb des Möglichkeitsraums“, so Manow, „muss bei dieser Betrachtungsweise von Politik bleiben, dass es für eine andere politische Position Gründe hätte geben können.“
In Demokratien braucht es jedoch den Blick für diese Möglichkeit. Das schärfste Schwert, das Demokrat*innen gegeneinander führen können, ist es, sich nicht mehr als Gleiche anzuerkennen. Feinden der Demokratie wird diese Gleichheit von der jeweiligen Gegenseite abgesprochen. Hierfür mag es Gründe geben, schließlich hat es immer antidemokratische Kräfte gegeben und das dürfte sich auch in Zukunft nicht ändern. Demokrat*innen müssen bestrebt sein, diesen Kräften Einhalt zu gebieten. Sie müssen aber gleichzeitig darauf achten, nicht die falschen Kräften auf diese Art bekämpfen zu wollen – denn politisch Andersdenkende sind nicht notwendigerweise Anti-Demokrat*innen.