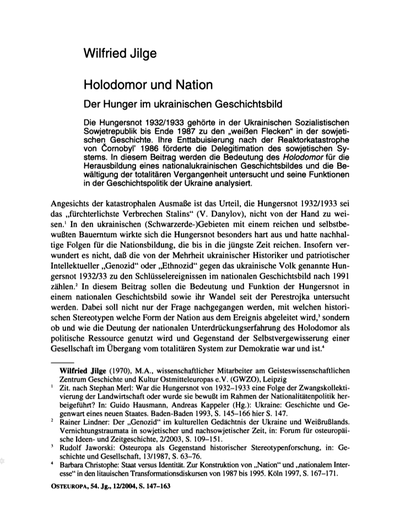Das größte Tabu in der Sowjetunion war die Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Bolschewiki, so der Osteuropahistoriker Wilfried Jilge.
Das Sprechen über die Hungersnot war während der repressiven Jahre des Stalinismus in den 1950er Jahren nicht möglich. Erst mit dem Beginn der Tauwetterpolitik Nikita Chruschtschows und seiner Verurteilung des Stalin-Regimes öffnete sich langsam der Weg für die öffentliche Thematisierung der Hungersnot. Diese wurde dann allerdings in der Vermittlung zumeist auf Missernten zurückgeführt und nicht auf Gesetzeserlasse Stalins, die den Hunger bewusst in Kauf nahmen. Während der Perestroika der späten 1980er Jahre wurde das Tabu dann aufgebrochen. Gorbatschows Reformpolitik eröffnete einen neuen Raum des Sagbaren. Die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Stalinismus fand ihren Weg in den politischen Alltag und die Zivilgesellschaft. Mit der Unabhängigkeit der Ukraine war es dann politisch vollends akzeptabel, über die Gewalt des Stalinismus zu sprechen.
Jilges Aufsatz stammt aus dem Dezember 2004, hat aber nichts an Aktualität eingebüßt, da er zwei bis heute grundlegende Positionen skizziert: Zum einen gibt es die Perspektive einer ethnisch-kulturell motivierten Massenvernichtung (Genozidthese), zum anderen die Vorstellung einer gesamt-sowjetischen Tragödie. Aktuelle Forschungsbeiträge zeugen von der Aktualität von Jilges Analyse: Anne Applebaum und Serhii Plokhy sind etwa Vertreter der Genozidthese, im Gegensatz dazu ordnet der Berliner Historiker Robert Kindler den Holodomor in den Kontext anderer sowjetischer Hungersnöte in den 1930er Jahren ein.
Jilge beschreibt die Erinnerung an den Holodomor als eine „politische Ressource”, die für die politische Eliten in der Ukraine unterschiedliche Funktionen erfüllte und erfüllt: Distanzierung von Russland, Stärkung der nationalen Einheit, oder zur Loslösung von sowjetischen Narrativen.