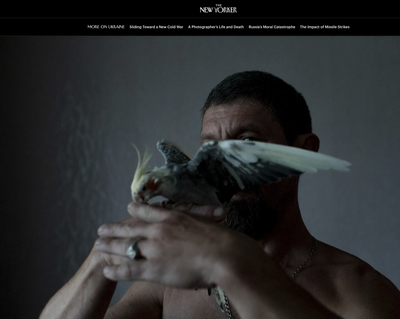Mitte März 2022, weniger als einen Monat nach der russischen Invasion, unterschrieb der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskij ein neues Gesetz: Artikel 111(1) des ukrainischen Strafgesetzbuches regelt fortan den Umgang mit Kollaborateur*innen im Krieg Russlands gegen die Ukraine. Seitdem arbeiten die Strafverfolgungsbehörden der Ukraine gemeinsam mit dem ukrainischen Geheimdienst SBU daran, Menschen, die mit den russischen Besatzungstruppen zusammengearbeitet haben oder noch zusammenarbeiten, zu identifizieren und juristisch zur Rechenschaft zu ziehen.
Joshua Yaffas Recherchen zeigen, dass die Umsetzung des Artikels nicht nur den Staat, sondern vor allem die ukrainische Gesellschaft mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Rechtlich scheint der Tatbestand der Kollaboration zunächst klar beschrieben. Er ist im Allgemeinen als absichtsvoller Akt definiert, der die Souveränität und territoriale Integrität des ukrainischen Staates verletzt. Ein solcher Befund ist in jenen Fällen einfach festzustellen, in denen eine Person aktiv gegen die ukrainischen Streitkräfte kämpft, für die russische Armee spioniert oder Sabotageakte gegen die ukrainische Infrastruktur begeht. Wie Yaffa allerdings anhand zahlreicher Beispiele zeigt, ist eine eindeutige Feststellung von Kollaboration auf lokaler Ebene oft viel schwieriger.
Verantwortlich hierfür, so Yaffa, seien eine Reihe von Faktoren. Seine Reportage erlaubt einen eindrücklichen Blick auf die repressive, aber dennoch komplexe Realität der russischen Besatzung der Stadt Isjum. Die größte Herausforderung für die ukrainischen Strafverfolger*innen ist ein juristisch stichfester Nachweis des Motivs zur Kollaboration. Oft sei es im Nachhinein – Wochen, meist sogar Monate nach der Besatzung – unmöglich herauszufinden, ob sich jemand aus freien Stücken oder unter Androhung von Gewalt mit dem Besatzungsregime arrangierte. Die finanzielle Dimension verkompliziere zusätzlich die Ex-post-Feststellung der Kollaborationsabsicht: So stoppte die Ukraine im März 2022 die Zahlung von Gehältern an Staatsangestellte in den besetzten Gebieten. Wie Yaffa rekonstruiert, hätten daraufhin zahlreiche Bewohner*innen der Stadt begonnen, sich mit den „neuen Herrscher*innen” zu arrangieren und für diese zu arbeiten – oft aus schierer finanzieller Not. Dies habe mehrere für die Besatzer wichtige Berufsgruppen betroffen: Lehrer*innen, Polizist*innen, Verwaltungsmitarbeiter*innen bis hin zu Bauarbeiter*innen und der Straßenreinigung.
Zum einen versichern die ukrainischen Strafbehörden, dass jeder Fall individuell geprüft werde, was durchaus Monate, wenn nicht gar Jahre in Anspruch nehmen könnte. Yaffa zeichnet detailliert nach, mit welchen Absichten und in welchen Kontexten Ukrainer*innen in Isjum mit dem Besatzungsregime zusammenarbeiteten. Einige habe die Angst vor russischer Repression angetrieben, andere hätten reale Sympathien für Russland und seine kriegerische Eroberung von Teilen der Ukraine. Wiederum andere hätten sich einfach opportunistisch verhalten oder aus Langeweile und dem Gefühl gehandelt, dass doch wieder irgendeine Normalität einkehren müsse – unter wessen Herrschaft auch immer. In einigen Fällen hätten es das Chaos und die Gesetzlosigkeit des Besatzungsregimes auch erlaubt, offene zwischenmenschliche Rechnungen aus der Vorkriegszeit zu begleichen, indem etwa Nachbar*innen beim russischen Militär als Angehörige der ukrainischen Streitkräfte gemeldet wurden – mit oft verheerenden Folgen für die daraufhin Festgenommenen. Dies alles habe sich in einem Kontext abgespielt, in dem die russischen Streitkräfte die Übernahme von Isjum als dauerhaft und unabänderlich erscheinen ließen.
Yaffas Darstellung spart die dunklen Seiten der ukrainischen Strafverfolgung nicht aus. So seien die ukrainischen Zahlen zu den in Isjum Befragten und Festgenommenen ein gut gehütetes Staatsgeheimnis. In einigen Fällen sei es zu gewalttätigen Verhören durch die ukrainische Polizei oder zu falschen Verdächtigungen gekommen. Aus dem Wissen um die kommende Suche nach Kollaborateur*innen, so Yaffa, seien viele Bewohner*innen Isjums den ukrainischen Befreiern mit gemischten Gefühlen begegnet. Freude über das Ende der Besatzung habe sich mit Misstrauen gegenüber dem ukrainischen Staat vermischt.
Die Erfahrung einer temporären und repressiven Besatzung sowie eines nach der Besatzung eintretenden allgemeinen Misstrauens zwischen Staat und Gesellschaft, aber auch innerhalb der Stadtbevölkerung, knüpft an ein tiefes historisches Trauma an. So habe Russlands Angriff die Erinnerung an die 1940er Jahre wachgerufen. Yaffa verweist darauf, dass sich bereits während des Zweiten Weltkriegs viele Ukrainer*innen ähnliche Fragen wie heute gestellt hätten, zunächst unter Nazi-, später unter Sowjet-Besatzung. Das Tragische an der von Yaffa dargestellten Realität des gegenwärtigen Krieges ist nicht zuletzt, dass erst die russische Invasion selbst die politisierten Trennlinien innerhalb der Gesellschaft in den ehemals besetzten Gebieten geschaffen hat. Was vorher nachbarschaftliche Fehden, eine amorphe Nähe zu Russland oder die apolitische Absicht Geld zu verdienen gewesen waren, überführte der Krieg mitunter in hochpolitische Akte des militärischen Verrats und der staatlichen Illoyalität. Nach dem Zurückdrängen der russischen Besatzer ist es nun an der Ukraine, einen menschlichen Umgang mit den gesellschaftlichen Uneindeutigkeiten des russischen Besatzungsregimes zu finden.