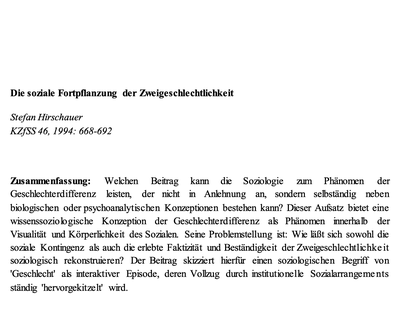In der öffentlichen Diskussion um Geschlechtsidentitäten und -rollen steht heute oft die Auseinandersetzung mit Sprache im Zentrum. Dabei gibt es auch jenseits der Sprache vielfältige gesellschaftliche Institutionen und Praktiken, die nach Geschlechtern trennen und so Differenzen nicht nur sichtbar machen, sondern auch herstellen.
Die Soziolog*innen Candace West und Don Zimmermann haben diese Praktiken 1987 mit ihrem Konzept des Doing Gender in den Fokus der sozialwissenschaftlichen Geschlechterforschung gerückt. Geschlechteridentitäten und -rollen werden von ihnen nicht als gegebene natürliche oder psychische Konstanten begriffen. Sie entstehen in der unmittelbaren sozialen Interaktion, werden von dieser getragen und geprägt. Geschlecht wird entsprechend aktiv durch die Art und Weise, wie wir sprechen, uns bewegen, kleiden oder auch gesellschaftlich in Erscheinung treten, immer wieder aufs Neue hergestellt.
Das Konzept rückt den Blick ab von einem Verständnis von Geschlecht als Kategorie, sei dieses biologisch oder sozial begründet, und hin zu den alltäglichen Prozessen, die diese Kategorien herstellen und stabilisieren. Es sind nach West und Zimmermann insbesondere auch Mikro-Aktionen, in denen die eigene Geschlechtsidentität konstruiert wird: eine flüchtige Geste, ein Wimpernschlag. Diese sind unbewusst und oft jahrelang in der elterlichen Erziehung, im Kindergarten, in der Uni und Populärkultur eingeübt. Im Verständnis der Autor*innen gibt es für das Individuum keinen Ausweg aus diesen Prozessen. Solange sich Menschen innerhalb einer Gesellschaft begegnen, die zwischen „Mann“ und „Frau“ unterscheiden, sind sie gezwungen, sich gegenüber als „Mann“ oder „Frau“ zu verhalten. Dagegen hilft auch die aktive Verweigerung nichts, die als Ausnahme nur die Regel bestätigt.
Doing Gender wurde in den Sozialwissenschaften lebhaft diskutiert und bildet heute einen der kanonischen Texte der Geschlechterforschung. Insbesondere die Frage des unbewussten Handelns führte dabei immer wieder zu Debatten: Ist Doing Gender tatsächlich unausweichlich? Oder gibt es ein soziales „Außerhalb“ der Konstruktion von Geschlecht?
Stefan Hirschauer schlägt 1994 mit seinem vielbeachteten Aufsatz Die soziale Fortpflanzung der Zweigeschlechtlichkeit in diese Kerbe. Er entwickelt das Konzept von West und Zimmermann weiter, setzt dem Doing Gender an entscheidender Stelle jedoch Prozesse des Undoing Gender entgegen: Momente der Interaktion, in denen Geschlechterdifferenz unwichtig wird oder nahezu verschwindet. Als ein zentrales Beispiel nennt Hirschauer die Sauna, wo Männer und Frauen einander nackt begegnen, ohne dass diese Situation in besonderer Weise geschlechtlich aufgeladen wäre.
Einem solchen freien Umgang wie diesem stünden in vielen anderen Fällen allerdings institutionelle Arrangements entgegen. Sie bilden nach Hirschauer den sozialstrukturellen Rahmen, in dem individuelle Begegnungen stattfinden, und schränken die Möglichkeiten des eigenen Verhaltens und der Konstruktion von Geschlecht innerhalb einer konkreten Situation wieder ein. Solche institutionellen Arrangements können für Hirschauer biologische Diskurse sein, die auf gesellschaftliche Fragen übertragen werden. Es sind aber auch schnöde Verwaltungsvorschriften. Es reiche schon ein zweigeschlechtlicher Fragebogen. Ebenso kann es physische Infrastruktur sein, etwa nach Geschlecht getrennte Toiletten. Nicht zuletzt spielt auch das persönliche Umfeld oder die eigene Biographie eine Rolle, die nach Kontinuität verlangt.
Gesellschaftliche Institutionen motivieren für Hirschauer beständig dazu, den Prozess des Doing Gender zu wiederholen. Geschlecht, sagt er, werde durch soziale Arrangements „hervorgekitzelt“.
Die Geschlechterdifferenz und ihre normative Ordnung werden nicht durch die Institutionen selbst stabilisiert, sondern durch die Individuen, die von diesen Institutionen geleitet werden, Geschlecht immer und immer wieder auf die gleiche Weise darzustellen. Doch auch die Wiederholung verläuft diskontinuierlich. Darstellungen von Geschlecht können im Verlauf der Interaktion auch in den Hintergrund treten und damit wiederum zu Momenten des Undoing Gender werden, auf die es Hirschauer ankommt: „der Prozess der Geschlechtskonstruktion besteht aus Episoden, in denen Geschlecht in sozialen Situationen auftaucht und verschwindet.“
Aus der Perspektive von Hirschauers Konzeption der „sozialen Fortpflanzung von Zweigeschlechtlichkeit“ erscheint auch langfristiger Wandel als eine Abfolge von Episoden, Wiederholungen und kleinen Freiräumen, die sich zwischen ihnen immer wieder eröffnen. Ein Beispiel ist das Degendering von Namen. Die Institutionen fungieren darin als gesellschaftliche „Trägheitsmomente“, wie Hirschauer sie nennt. Sie sind zwar langsam und erschweren die Bewegung – aber sie lassen sich verschieben.
Hirschauer will den Prozess des Undoing Gender entsprechend als eine „konstruktive Leistung“ und als „Gegenstrategie zu Sexuierungsprozessen“ verstanden wissen. Er erkennt individuelle Handlungsspielräume an. Durch diese können auch gesellschaftliche Interventionen, die auf Undoing Gender und die Überwindung bestehender Ordnungen abzielen, etwa durch gendersensible Sprache oder Quotensysteme in Wirtschaft und Politik, gerade gegenteilige Prozesse des Doing Gender hervorrufen.