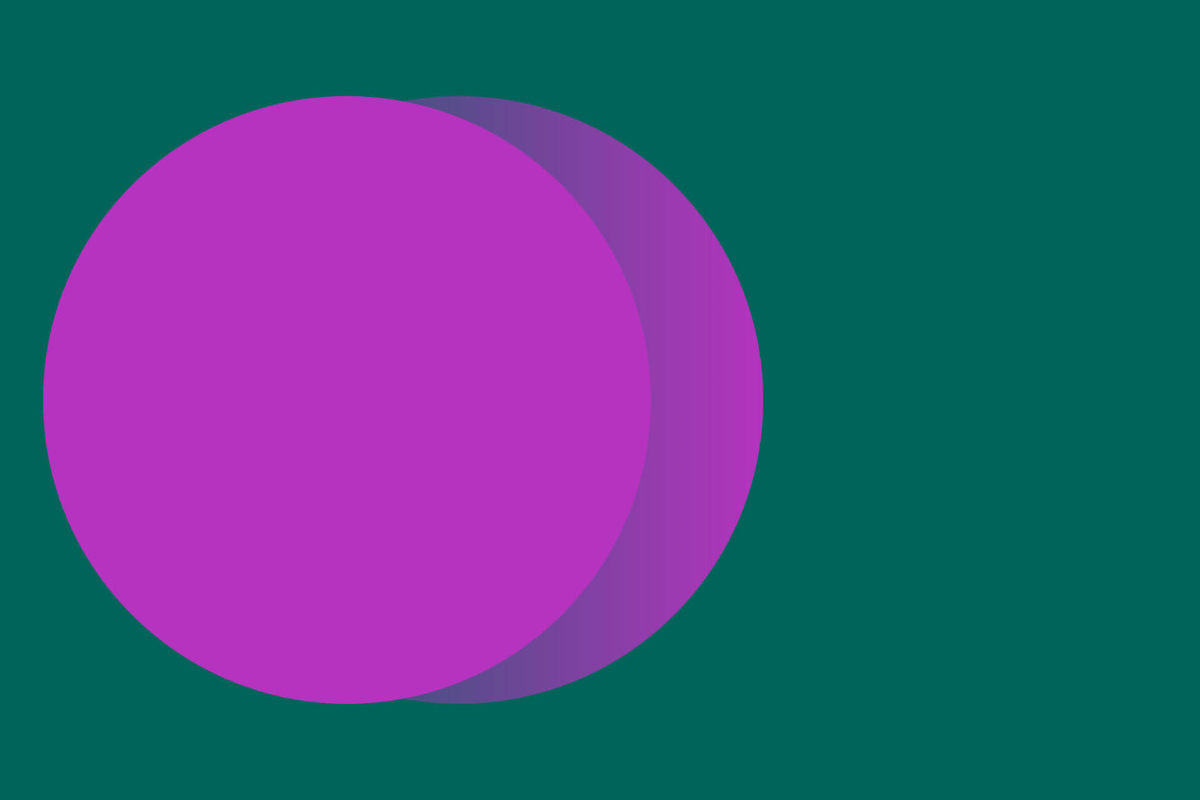Nie war es so einfach, schnell an unendlich viele Informationen zu gelangen wie heute. Zur selben Zeit lässt die Geschwindigkeit und Informationsdichte viele Menschen ratlos und überfordert zurück. Der Klimawandel, der sich immer deutlicher zeigt; die Biodiversitätskrise; Kriege im Sudan, in Palästina, der Ukraine und in weiteren Regionen sowie globale Pandemien. Wir sprechen von multiplen Krisen,
Wissenschaftskommunikation kommt heute eine zentrale Aufgabe zu
Das Prinzip „bad news are good news“ durchzieht unsere Medienlandschaft und unsere Social-Media-Plattformen. Es nutzt aus, dass unser Gehirn deutlich stärker auf negative als auf positive Umstände reagiert: Schlechten Nachrichten schenken wir mehr Aufmerksamkeit, wir verarbeiten negative Reize schneller und können uns besser an sie erinnern. In unserer heutigen Aufmerksamkeitsökonomie sorgt dieser sogenannte Negativitätsbias dafür, dass vor allem die schlechten Nachrichten per Push-Benachrichtigung auf unserem Handy aufblinken und Eingang in die Zeitungsüberschriften finden.
„Problem talk creates problems, solutions talk creates solutions“8
Die Neurowissenschaftlerin Maren Urner hat versucht, diese Frage für den Journalismus zu ergründen. Sie ist Mitbegründerin des 2016 gegründeten Online-Magazins Perspective Daily und eine wichtige Stimme des konstruktiven Journalismus im deutschsprachigen Raum. In ihrem Buch Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Wie wir uns gegen die digitale Vermüllung unserer Gehirne wehren können geht sie der Frage nach, wie unser Gehirn auf die alltägliche Informationsflut und den Negativitätsbias reagiert. Sie spricht von digitaler Abhängigkeit und Überforderung und zeigt Wege auf, dem kritisch und konstruktiv zu begegnen. Und – sie stellt die Idee des konstruktiven Journalismus als einen möglichen Ausweg aus dem Dilemma vor. Der konstruktive Journalismus möchte Rezipient*innen entlasten und unterstützen und so zur Lösung gesellschaftlicher Probleme und Herausforderungen beitragen. Im Mittelpunkt steht die Idee, bei jedem Thema immer auch die Frage „Wie geht es weiter?“ zu stellen. Das Bonn Institute beschreibt konstruktiven Journalismus mit Hilfe dreier Elemente: einem ausgeprägten Lösungsfokus; einem Perspektivenreichtum, der Diversität und strukturelle Aspekte miteinbezieht, sowie einem konstruktiven Dialog, in dem Journalist*innen auch als Moderator*innen für Austausch und Verständigung eintreten. Erkenntnisse der Mediationsforschung und der angewandten Sozial- und Kommunikationspsychologie werden mit eingebracht, um der Frage näher zu kommen, wie Kommunikation heute erfolgreich gelingen kann.
Von der Idee zur Umsetzung
Schon bei der Erstellung von Kommunikationskonzepten können konstruktive Ansätze mit einbezogen werden. Deswegen sollte Wissenschaftskommunikation schon früh ins Projekt integriert werden, und zwar bereits beim Einwerben und Konzeptionieren von Forschungsvorhaben und nicht erst bei der Veröffentlichung der Forschungsergebnisse. Die Einnahme einer konstruktiven Perspektive ist wichtig, denn „alles, was Du in die Welt setzt, beeinflusst andere Menschen“, schreibt Maren Urner. Wir spüren das: Negative Emotionen wie Wut und Angst gehen mit körperlichen Reaktionen einher. Schlechte Nachrichten versetzen uns in eine Stresssituation. Im „Kampf-oder-Flucht-Modus“ sind wir weder aufmerksam noch handlungsbereit. Im Gegenteil: Viele Menschen wenden sich von Berichten ab, die auf einseitige und negative Weise die Welt erklären. Ein Verhalten, das weder hilft, die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu verstehen noch ihnen zu begegnen.
Was bedeutet dabei der Kampf um die Ressource Aufmerksamkeit
Wissenschaftskommunikation kann Dialogräume für den Austausch von Lösungsansätzen erschließen, konstruktive Debatten initiieren und über das Bereitstellen von evidenzbasierten Forschungsergebnissen mit gesellschaftlichen Gruppen und Stakeholdern ins Gespräch kommen. Und das nicht nur darüber, wie nachhaltige und gerechte Zukünfte aussehen können, sondern auch darüber, was jetzt schon gut funktioniert. Dabei muss die Rolle und das Selbstverständnis von Wissenschaftler*innen dahingehend weitergedacht werden, neben der Wissensproduktion auch stärker die Wissenskommunikation im Blick zu haben. Es ist dringend an der Zeit, darüber nachzudenken, wie wir unsere Kommunikation in Anbetracht der immensen Herausforderungen neu ausrichten können. Eine Wissenschaftskommunikation, die sich am Vorbild des konstruktiven Journalismus auf den Weg macht und in Zeiten der Polykrisen zielgruppenorientiert und konstruktiv auch auf den großen Plattformen kommuniziert, leistet einen notwendigen Beitrag für sozialen Zusammenhalt, die Sicherung unserer Demokratie und das Gestalten nachhaltiger Zukünfte.