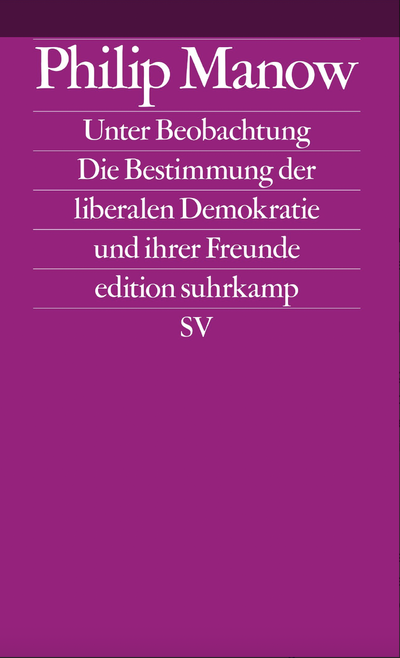Grundlegend für Manows Überlegungen ist seine Forderung, die Demokratie zu
Auf den ersten Blick überraschend konstatiert Manow, dass es die liberale Demokratie überhaupt erst seit den 1980er-Jahren gebe. Er kommt zu diesem Schluss, weil er unter liberaler Demokratie eine bestimmte institutionelle Ausgestaltung demokratischer Systeme versteht. Sein Fokus liegt hierbei auf liberalen Institutionen, die den demokratischen Mehrheitswillen in bestimmten Schranken halten, und zwar Verfassungsgerichte mit dem Recht auf
Für Manow wurden demokratische Mehrheiten nach 1990 jedoch nicht nur durch die Etablierung dieser nationalen Verfassungsgerichtsbarkeiten an die Leine gelegt, sondern zusätzlich durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Weil das nationale Recht der Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Einklang mit dem Europarecht stehen muss, können legislative Akte dem EuGH zur Prüfung vorgelegt werden, wenn sie Europarecht betreffen. Da dies sehr häufig der Fall ist, stehen viele parlamentarische Mehrheitsentscheidungen unter dem Vorbehalt, vom EuGH zurückgewiesen zu werden. Der EuGH fungiert dann als starkes Verfassungsgericht – und zwar selbst dann, wenn es ein solches auf der nationalen Ebene nicht gibt. Laut Manow wurden die Kontrollmöglichkeiten in den vergangenen rund 25 Jahren exzessiv genutzt, auch weil sich manche Verfassungsrichter*innen für die besseren Gesetzgeber*innen gehalten hätten. Mit anderen Worten: „Die Justizialisierung politischer Konflikte [zieht] regelmäßig die Politisierung der Justiz nach sich“.
Von der elektoralen zur liberalen Demokratie – und wieder zurück?
Vor diesem Hintergrund, so Manow, sei ein nüchterner Blick auf die Orbáns, Erdoğans, Kaczyńskis und Netanjahus dieser Welt geboten. Statt den Untergang der Demokratie herbeizuschreiben, sollten Politikwissenschaft und Medien den Populismus als das sehen, was er ist: Die Reaktion auf einen Wandel der
Manow stellt sich mit seinen Ausführungen unter anderem gegen die in den letzten Jahren immer wieder vertretene These, der zufolge populistische Parteien vor allem aufgrund des Siegeszugs
Wie schon in seinem letzten Buch plädiert Manow also für weniger Aufgeregtheit im wissenschaftlichen und öffentlichen Diskurs. Die Debatte um Populismus und Demokratie dürfte er damit zweifelsfrei bereichern. Die Frage ist, ob er die Befürworter*innen der so genannten „illiberalen Demokratie“ etwas zu einseitig in den Blick nimmt. Geht es ihnen tatsächlich in erster Linie darum, der Mehrheit wieder zu ihrem Recht zu verhelfen? Oder deuten etwa Wahlrechtsreformen und Einschränkungen zivilgesellschaftlicher Aktivitäten nicht eher darauf hin, dass bestehende Mehrheiten gegen jedwede oppositionelle Herausforderung immunisiert werden sollen? Letzteres hätte mit Demokratie nicht mehr viel zu tun, sei sie nun liberal oder elektoral.