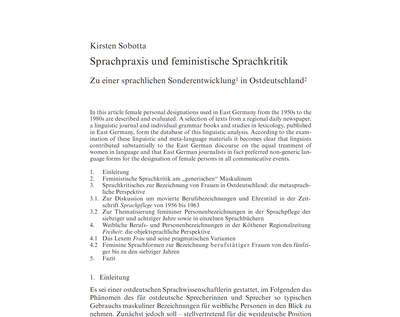Unmittelbar vor der Wiedervereinigung lag die Erwerbsquote von Frauen in Ostdeutschland bei 91%, in Westdeutschland betrug sie nur 51%. Auch wenn die Ungleichheit in der Berufshierarchie stark blieb und die meisten Frauen durch Haushaltsarbeit doppelt belastet waren: In der beruflichen Gleichstellung war die DDR dem Westen voraus.
Und ausgerechnet in diesem in Sachen Geschlechterrollen fortschrittlicheren Deutschland sprach man von „Frau Direktor“ und „Frau Minister“ – und meinte damit nicht die Gattinnen der hochgestellten Herren? Das sollte einem dann ja in der heutigen Diskussion um Feminin-Formen, Gendersterne und Glottisschläge zu denken geben. Wenn es so gut geht ohne sie – wo liegt dann ihr Gewinn?
Kirsten Sobotta hat sich bereits 2002 relevante Auszüge des ostdeutschen Schriftkorpus der 1950er bis 1980er Jahre angesehen und kommt zu dem Schluss: So eindeutig
In der Zeitschrift Sprachpflege gab es in den 1950er und 1960er Jahren eine rege Diskussion um das
Die Redaktion selbst resümierte 1963 zugunsten des Anliegens, mehr weibliche Formen zu verwenden: „Wenn offiziell dokumentiert wird, daß die weibliche Sprachform keine Zurücksetzung der Frau gegenüber dem Mann ausdrückt, so wird auch das Bedenken immer mehr zurücktreten, sprachlich richtige weibliche Dienstbezeichnungen und Ehrentitel im offiziellen Sprachgebrauch zuzulassen.“ Die metasprachliche Ebene sollte es also richten: Wenn allen klar wird, dass die Endung „-in“ nicht als Benachteiligung zu verstehen ist, dann könne man sie auch ohne Bedenken verwenden.
Oder weiterverwenden? Denn in der Sprache vorhanden waren die weiblichen Formen ja sowieso. Dass ein ständiges Tauziehen um ihre Verwendung oder Nichtverwendung stattfand, darauf weist auch der Linguist Wilhelm Schmidt in seinen Grundfragen der deutschen Grammatik (1965) hin, einem Standardwerk insbesondere für den Deutschunterricht in der DDR: „In unserer Gegenwartssprache greift in den letzten Jahren eine Entwicklung um sich, die viel diskutiert wird und recht umstritten ist; das ist die Unterdrückung des femininen Genus bei Berufsbezeichnungen und Titeln. [...]. Das Vordringen dieses Sprachgebrauchs bedeutet zweifellos eine Verarmung der Ausdruckskraft unserer Sprache; es führt vielfach zu Härten im Ausdruck und zu logischen Absonderlichkeiten, [...] und es ist obendrein in Wahrheit gerade nicht der Ausdruck der Gleichberechtigung der Frau, sondern eher das Gegenteil davon.“
Hier ist von einer Unterdrückung des femininen Genus bei Berufsbezeichnungen und Titeln die Rede – was impliziert, dass sein Gebrauch offenbar zuvor recht weit verbreitet war.
Darauf deuten auch Sobottas Befunde aus der Zeitschrift Freiheit hin, wo sich in den 1950er, 60er und 70er Jahren zahlreiche Ingenieurinnen, Nationalpreisträgerinnen, Betriebsleiterinnen und Genossinnen finden lassen, mehr oder wenig bunt durchmischt mit den entsprechenden generisch-maskulinen Formen wie Korrespondent, Leiter oder Oberrichter (ebenfalls für weibliche Personen verwendet). Die Autorin bemerkt einschränkend: „Allerdings konnte eine Dominanz nicht-generischer Sprachformen nur in jenen Zeitungstexten festgestellt werden, die über den Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD) bzw. über Aktivitäten seiner Mitglieder berichteten.“
Es hat also ganz offenbar auch im DDR-Sprachgebrauch eine Konkurrenz zwischen generisch-maskulinen und spezifisch-femininen Bezeichnungsweisen für Frauen in ihren jeweiligen Rollen und Berufen gegeben. Und auch im Osten Deutschlands scheint die Präferenz für die eine oder die andere sprachliche Lösung stark vom Kontext der jeweiligen Äußerung abhängig gewesen zu sein und nicht zuletzt von ihrer politischen Intention.
Ob die Gesamthäufigkeit des generischen Maskulinums, wie das Klischee es will, nun im Osten Deutschlands nicht doch höher war als im Westen, darüber kann die Untersuchung keinen Aufschluss geben. Wenn Angela Merkel 1989 im Bundestag von sich sagte: „Ich bin Realist“ (wie bei Sobotta zitiert), dann folgte sie damit jedenfalls keiner ehernen Regel des DDR-Sprachgebrauchs, sondern auch nur einer seiner möglichen Optionen.