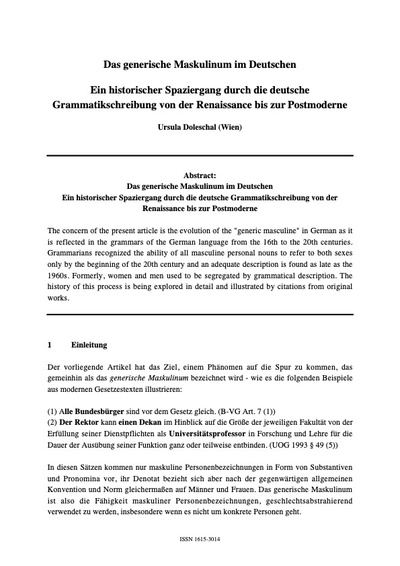So war es nämlich im Englischen, wo 1850 per Gesetz festgeschrieben wurde, dass als generisches Personalpronomen nicht das bis dahin übliche they (das inzwischen seine Rückkehr feiert) zu verwenden sei, sondern das aus dem Maskulinum stammende he. Aus Formulierungen wie „anyone may live their dream“ wurde: „Anyone may live his dream“.
Ein vergleichbares „patriarchales normatives Ergreifen“ gab es bei uns nicht, stellt Ursula Doleschal in ihrer Rückschau der deutschen Grammatikschreibung vom 16. bis ins 21. Jahrhundert fest. Allerdings war das generische Maskulinum wohl auch nicht seit jeher so in Gebrauch, wie wir es heute kennen.
Für die generische, also geschlechtsunspezifische Bezugnahme auf Personen kannten die Grammatiker der Renaissance noch ein geschlechtsneutrales „
Lässt sich aus diesen Befunden etwas über die Beziehung von Genus und Sexus ableiten, die ja ebenfalls in der Diskussion ums Gendern eine Schlüsselrolle spielt? Andere Sprachhistorikerinnen, wie Elisabeth Leiss
Welche der beiden Schulen auch immer der Wahrheit näher sein mag – einig sind sie sich darin, dass es immer wieder Wandel und Bewegung im deutschen Genus-System gab. Auch das generische Maskulinum ist damit keine ewige Wahrheit der deutschen Sprache, sondern ein Phänomen, das historischen Dynamiken unterliegt und von der sprachlichen Aktualität ständig auf seine Brauchbarkeit getestet wird.
Interessant an Doleschals Beitrag sind neben den zahlreichen Sprachbeispielen aus dem frühen Neuhochdeutschen (die Doctrin als feminin-Form zu Doctor, der & die Gevatter, der & die Gespons als genus commune), als die Grammatikschreibung noch auf Latein stattfand, auch die Hinweise zu den DDR-Grammatiken, die, so die Autorin, ähnliche Regeln formulierten wie die westdeutschen. Die einschlägige Untersuchung von Kirsten Sobotta