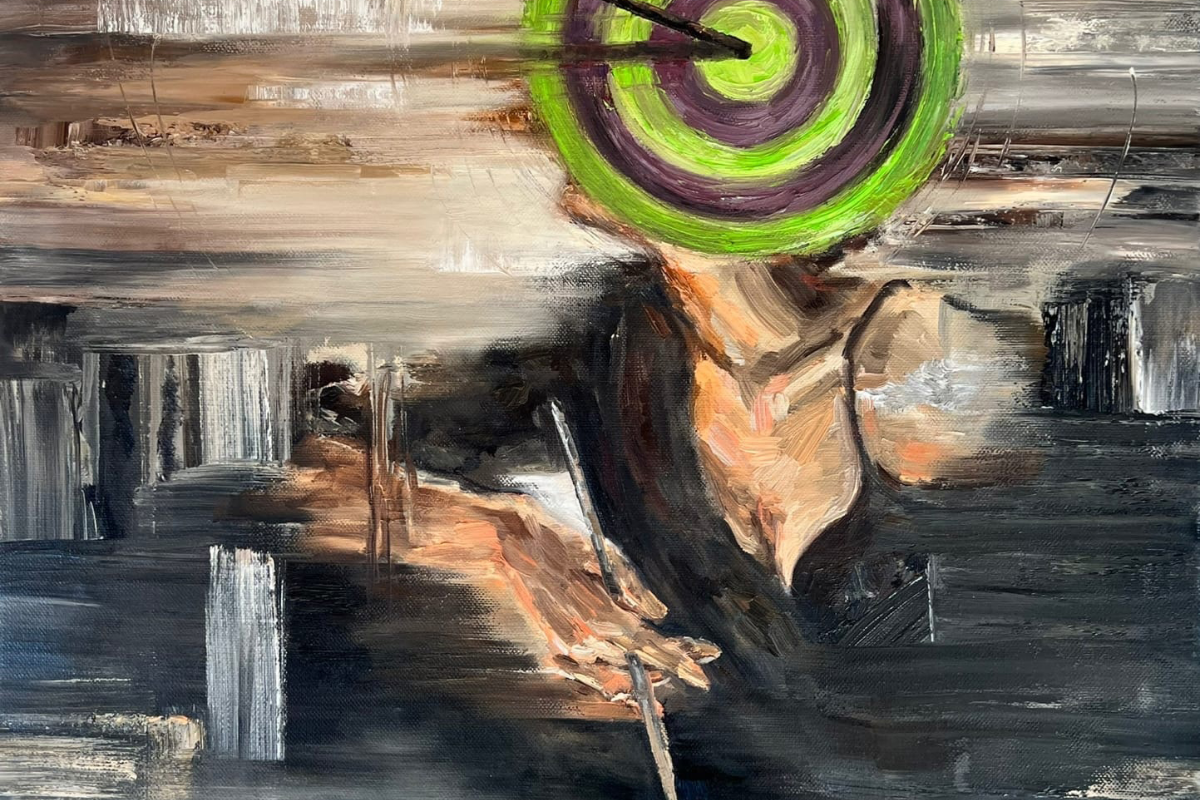„Man unterscheidet die Gemeinschaften nicht nach ihrer Falschheit oder Richtigkeit, sondern nach der Art und Weise, wie diese imaginiert werden“, schreibt Benedict Anderson.
Das erlittene Trauma verbindet stärker als eine Utopie
Das gestern erlittene Trauma konsolidiert stärker als eine Utopie von Morgen. Die Zeit der auf die Zukunft gerichteten Erinnerungskultur ist passé; nicht mehr der Sozialismus als Utopie oder der Kosmopolitismus des Weltbürgertums kann Gesellschaften zusammenhalten. In dem von François Hartog geprägten Begriff des Präsentismus (présentisme) kommen gestern und heute zusammen und verschmelzen zu einem Zeitgefühl, in dem das Gestrige viel wichtiger ist als die Zukunft.
Ähnlich wie bei dem Begriff der Nostalgie in seinem primären und umgangssprachlichen Sinn geht es um Sehnsucht nach Vertrautem, nach der Geborgenheit des Kindseins. Der Wissenschaftler Carl von Linné notierte einmal in seinem Notizbuch kurz und bündig die Definition der Nostalgie: Nostalgie = Stenbrohult. So heißt das schwedische Dorf, in dem er seine Kindheit verbracht hatte. Das Morgige wird nicht mehr idealisiert, bewundert, affirmativ antizipiert. Es geht um die Rückkehr zu dem, das man schon kennt und dem man vertraut.
Das nationale Projekt kehrt zurück
Nichts ist vertrauter und bekannter in der Ideengeschichte der Menschheit als das nationale Projekt. Es ist paradox: In unserer globalisierten Welt, in der Migrationen und Transfers eigentlich das Nationale (und alles was mit Grenzen zu tun hat) als überkommene Idee erscheinen lassen, erlebt gerade die Nation eine Renaissance als Bezugspunkt der kollektiven Identität. Mit ihr zusammen – der Gedanke, dass Nation durch Geschichte gemacht ist – also ein antiquiertes, essentialistisches Denken der nationalen Erwecker des 19. Jahrhunderts.
Warum ist das so? Der erste Grund dafür ist der globale Shift in den Erinnerungskulturen, den wir in den letzten zwei Jahrzehnten beobachten. Im Zuge der globalen Krise der Identität, verstärkt durch neue Medien und Technologien, verspüren die gegenwärtigen Staatseliten eine
Der zweite Grund ist der veränderte Umgang mit Emotionen, vor allem mit dem Schrecken der Vergangenheit. Die „Kultur der Wunde“
Die Referenz auf den Holocaust als Trauma des 20. Jahrhunderts
Denkt man an die Zeit nach dem Trauma des 20. Jahrhunderts – dem Holocaust – kann der Unterschied nicht größer sein. Weder in der Sowjetunion noch im Westen war man bereit, in die Vergangenheit zurückzublicken. „Man ist versucht, sich mit Schaudern abzuwenden und nicht hinzusehen“, schrieb einmal Primo Levi dazu und plädierte: „Das ist eine Versuchung, der man widerstehen muss.“ Dazu kam, dass die festen Rahmungen der sinnstiftenden Kultur keine Sprache für leidvolle Erfahrungen hatten, was die Kommunikation des Traumas zu einer ungemein schwierigen Angelegenheit machte.
Die Literatur der Moderne von Ernest Hemingway bis Boris Polewoi feierte den starken Menschen, und auch auf der alltäglichen Ebene bestand die Strategie im Verdrängen des Verlustes oder seiner Überlagerung mit Heroik und Sinnstiftung. Das Nicht-Erzählen-Wollen half zu überleben, entsprach dem Wunsch, sich und seine Biografie zu „normalisieren“. So war das Nicht-Beachten des Traumas symmetrisch: Auf der Seite der Betroffenen half es zu überleben, auf der Seite ihrer Umgebung half es zu verdrängen, um nicht helfen zu müssen oder den Schrecken der anderen von sich fernzuhalten. Die Selbst-Heroisierung bot den Schutz vor einer „wirklichen“ Auseinandersetzung mit der Erinnerung, die weh tat und die ganze Grausamkeit des Erlebten offenbarte. Diese Erinnerungslogik, die am stärksten durch die Sprache des Kommunismus („Nicht trauern – kämpfen!“) unterstützt wurde, blieb im Übrigen von der klassischen Erinnerungstheorie unbeachtet.
Schließlich wurde in der westlichen Erinnerungstheorie auch die Rolle der jüdischen Kämpfer gegen die Nazis – und ihr auf den eigenen Beitrag zum Sieg und zur Befreiung ausgerichteter Gedächtnisdiskurs – ausgeblendet. Ihr Wunsch, sich an sich selbst und die Angehörigen heroisch zu erinnern und auch die Denkmalform so zu gestalten (siehe u.a. Nathan Rappaports Mahnmal für die Aufständischen des Warschauer Ghettos), wurde mit den sowjetischen Zensurschranken erklärt.
Das Trauma und seine Repräsentationen wurden zu den zentralen Themen der Erforschung der Holocausterinnerung. James Young zeigte die Ästhetisierung des Traumas in Holocaustmahnmalen
Diskursabstraktionen und Psychologisierung
Mit diesem absoluten Ansatz wird jede Geschichte als Trauma erzählt, der Opferbegriff überladen.
Der Satz Joan Didions, „wir erzählen uns Geschichten, um zu leben“, bringt es gut auf den Punkt. Die Arbeit mit dem Begriff des Traumas offenbart also nicht den spezifischen historischen Kontext, der zur Produktion oder Dekonstruktion des kollektiven Gedächtnisses beigetragen hat. Dass sich traumatische Ereignisse im kulturellen Gedächtnis widerspiegeln, hängt vielmehr mit dem zeitgenössischen Interesse an einem bestimmten Umgang mit der Erinnerung zusammen.
So wie heute. Die inflationäre Nutzung der Begriffe wie Genozid und Trauma ordnet sich in den Zeitgeist mit seiner Vorliebe für Empathie und Authentizität ein, der auch das öffentliche Teilen von Gefühlen mitbringt. Bezeichnenderweise waren es Frauen, die sich als Philosophinnen, Künstlerinnen und Schriftstellerinnen dieser Gefühligkeit kritisch entgegenstellten. Simone Weil, Joan Didion und Susan Sontag hielten es für ihre Pflicht, sich der schmerzhaften Realität zu stellen, doch sie hielten es genauso für notwendig, ihre Gefühle dabei im Zaum zu halten. Denn: Aus Mitgefühl könne eine Befriedigung erwachsen, sei es narzisstischer (Zurschaustellung der eigenen Empathie steigert das Selbstwertgefühl) oder moralischer Art (ich gehöre allein dadurch zu den Guten, dass ich mich schlecht fühle).
Die kritischen Fragen ethischer und politischer Art, die das Feiern der neuen Gefühligkeit auslöst, tangieren jedoch nicht die neue Tendenz der globalen Erinnerungskultur – nämlich den genocide turn. Zunächst wurde er von Museumsforschern registriert und festgehalten: Memorial Museums: The global rush to commemorate atrocities von Paul Williams
Opferzentrierte Erinnerungspolitik auf der globalen Agenda
War die Logik der globalen Erinnerungskultur vormals auf den Holocaust ausgerichtet und auf das geteilte Wissen über „uns selbst als Mörder und als Opfer“ (Péter Esterházy), verschwindet nun der Wunsch der Gesellschaft, sich selbst als Täter oder Mittäter zu sehen. Statt des eindeutigen und singulären „Nie wieder Auschwitz!“ stellen nun multiple Genozide den Erinnerungsanker. Aus dem „doppelten Genozid“, den „zwei Totalitarismen“ usw. kann man nach Belieben Lehren ziehen. Die gesellschaftliche Erinnerung ist auf die Entwicklung der Empathie ausgerichtet und vor allem auf die Förderung der Artikulierung der traumatischen Erfahrung. Das Trauma bekommt somit eine politische Konjunktur: Man wird aufgefordert, das Trauma öffentlich zu teilen. Paradoxerweise verspricht man sich die Überwindung des Traumas gerade durch dessen öffentliche Manifestation. Die „Heilung“ soll durch die Monumentalisierung und Sakralisierung des Traumas erreicht werden. Kaum jemand stellt sich die Frage, was dies mit unserer Gesellschaft macht. Der Satz Churchills über den Balkan, „sie produzieren mehr Geschichte, als sie jemals verdauen können“, kann nun auf Trauma angewendet werden: Man produziert mehr Trauma, als man jemals überwinden kann.
Doch das Trauma wurde nicht nur als Bezugspunkt der nationalen Erinnerung zentral. Auch als analytischer Ansatz wird es benutzt, um die Defizite der Erinnerungskultur zu beschreiben. Als Alexander Etkind in seinem Buch Warped Mourning. Stories of the Undead in the Land of the Unburied
Exemplarisch dafür kann die Analyse des Slawisten und Kulturpsychologen Gasan Gusejnov gelten. Die Erfahrung des Stalinismus und Probleme der sowjetischen Gesellschaft mit „Vergangenheitsbewältigung“ nutzt er als Erklärung für die gegenwärtigen Probleme der Russen mit ihrer Politik. Den Zerfall der Sowjetunion 1991 stellt er neben die Stunde Null in Deutschland (!) und allein dieser Ansatz, 1991 und 1945 zu vergleichen, macht die Schrägheit der Trauma-Analyse überdeutlich. 1945 war der Nationalsozialismus in seiner höchsten, radikalsten und mörderischsten Phase am Ende des Krieges angelangt. Dies mit der spätsowjetischen Zeit zu vergleichen und zu fragen, warum 1991 nicht als Befreiung wahrgenommen wurde, ist eine Verabschiedung von der Empirie.
Etwas mit psychologischen Begriffen zu pathologisieren kann helfen, sich von Akteuren bzw. Diskursen abzugrenzen, sie als etwas Fremdartiges darzustellen. Die Strategie ist universell und sehr bequem. Gegenüber Russland helfen dabei solche Begriffe wie „post-imperiales Syndrom“ oder „homo sovieticus“. Psychologisierung meint dann auch immer affektive, auf (negative) Emotionen gerichtete Deutungsangebote. Dass es einmal anders war, zeigt u.a. das weit bekannte universalistische Konzept Hannah Arendts „Banalität des Bösen“: Das Böse ist dem Menschen immanent, jeder von uns kann durch bestimmte Frakturen zu einem Täter werden, die Gewalt kann eine Dynamik entwickeln, die wir in unseren gesellschaftlichen Strukturen nicht mehr kontrollieren können. Dieses Konzept ist passé.
Schließlich hat auch Russland, womöglich die letzte Bastion der heroischen Erinnerungskultur in Europa, für sich die Opferrolle entdeckt. Seit 2020 ist in Russland eine erinnerungspolitische Offensive von ungesehenem Ausmaß zu erkennen. Staatliche und gesellschaftliche Akteure bringen den Schrecken des Krieges an die Öffentlichkeit. Sie sprechen von Opfern unter Zivilisten in den besetzten Gebieten der Sowjetunion und vom „Genozid“. Dieser aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs aktualisierte Diskurs ist enorm emotionalisierend, enorm moralisierend – und deswegen enorm handlungsleitend. Die Geschichtspolitik in Bezug auf den Krieg ist nun nicht mehr nur Siegestriumph, sondern ein Genozid-Diskurs, der erlaubt, alte normativ und emotional aufgeladene Begriffe wie „Faschisten“, „Nazis“, „Kollaborateure“, „Okkupation“ ins Gedächtnis zu rufen und neu zu besetzen.
Spätestens hier sollte uns diese Konjunktur des Genozid-Begriffes zu denken geben. Hat etwa die inflationäre Nutzung der Begriffe des Genozids, des Traumas, des Opfers zu ihrer Aushöhlung geführt? Wann ist es zu viel an Emotionen und Sentimentalität, wann versperren sie uns den Blick auf die Vergangenheit? Bereits Reinhart Koselleck stellte fest: „Wo alle Opfer sind, gibt es keine Täter“
Ob unsere inflationäre Nutzung der Begriffe, die Verwischung der Gewissheiten über die Singularität, die Rhetorik von „memory wars“, Erinnerungskriegen, „erinnerungskulturellem Schlachtfeld“ zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wurde? „Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein“, hieß es bei Nietzsche. Beschwört man die „memory wars“ weiter, führen sie womöglich zu echten Kriegen.