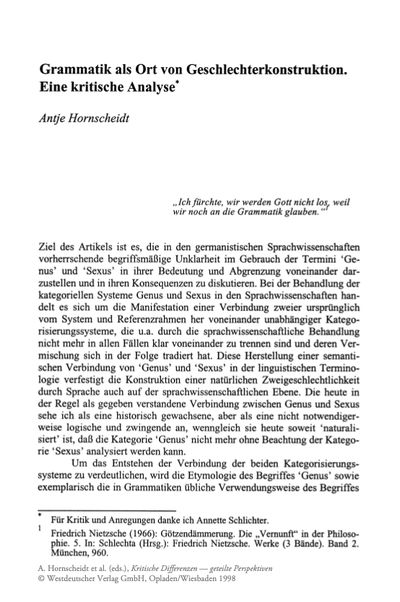Es heißt im Deutschen „der Tisch“ und „die Gabel“. So wie es „der Mann“ und „die Frau“ heißt. Doch inwiefern kann man deswegen von einem Sinnzusammenhang zwischen Genus (grammatischem Geschlecht) und Sexus (biologischem Geschlecht) ausgehen? Hat das eine überhaupt mit dem anderen zu tun?
Genus und Sexus, so Lann Hornscheidts
Bis heute haben Sprachwissenschaften nicht eindeutig klären können, wie Genuskategorien in Sprachen entstanden sind. Hornscheidt zeichnet nun aber nach, wie sich die Suche nach Antworten über Jahrhunderte auch als eine Suche nach Entsprechungsbeziehungen zwischen grammatischem und biologischem Geschlecht gestaltet hat. Zwar liefern die griechische Antike, die Arbeiten von Jacob und Wilhelm Grimm oder die moderne Psycholinguistik unterschiedliche Sichtweisen, wie die Beziehung gestaltet sein mag. Stets bleibt aber die Grundannahme erhalten, dass Genus und Sexus auf die eine oder andere Art in einem Verhältnis zueinander stehen.
Zudem, das ist der zweite Kritikpunkt Hornscheidts, gehe die Sprachforschung dabei stets vom Sexus als Kategorie natürlicher Zweigeschlechtlichkeit aus, ohne dass diese Annahme selbst problematisiert würde. Die soziale Konstruktion von Geschlecht, eine
Einer solchen Vorstellung stellt Hornscheidt feministische Positionen gegenüber, die im Anschluss an die
Mit einer solchen Sprachauffassung kann nun für Hornscheidt auch nicht mehr von einem natürlichen Zusammenhang zwischen Genus und Sexus ausgegangen werden. Stattdessen müsse eine kritische Aufarbeitung der Geschichte der Sprachforschung und ihrer Beschreibungen und Kategorisierungen erfolgen. Entgegen ihres rein deskriptiven Anspruchs, die Gesetzmäßigkeiten der Sprache lediglich nachzuzeichnen, müsse die Grammatik als präskriptive Disziplin verstanden werden. Grammatische Nachschlagewerke lieferten keine objektiven und neutralen Beschreibungen. Wer sie als Leitfaden für „richtiges Sprechen“ versteht, reproduziere und naturalisiere damit Normvorstellungen.
Durch eine Problematisierung des Verhältnisses von Genus und Sexus verkompliziert sich schließlich auch die feministische Linguistik, wie sie in Deutschland etwa maßgeblich von Luise F. Pusch vorangetrieben worden ist. Auch an deren berühmter „feministischer Kongruenzregel“, wonach sich eine Frau niemals mit einem Maskulinum bezeichnen sollte, kritisiert Hornscheidt die Vermischung von grammatikalischen und außersprachlichen Kategorien. Wer feminines/maskulines Genus mit Referenzen auf weiblichen/männlichen Sexus gleichsetze, drohe das bestehende Geschlechtersystem leichtfertig zu reproduzieren.
Dies bedeute aber im Umkehrschluss nicht, dass man derartige Positionen mit dem schlichten Verweis abtun könne, dass Genus und Sexus nichts miteinander zu tun hätten. Denn selbst wenn Genus und Sexus einmal unabhängige Kategorisierungssysteme gewesen sein mögen, so könne dies heute — durch die Geschichte der Linguistik begründet — nicht mehr gesagt werden. Für heutige Sprecher*innen sind Genus und Sexus sehr wohl miteinander verbunden. Nur ist dies eben nicht Ausdruck einer natürlichen Verbindung beider Kategorien, sondern Ergebnis eines historischen Prozesses.
Hornscheidt teilt grundsätzlich die Kritik an vorherrschenden Ausdrucksformen im Deutschen, die eine Asymmetrie in der Geschlechterrepräsentation zur Folge haben, sieht jedoch Veränderungsstrategien kritisch, die etwa auf Beidnennungen abzielen. Sie drohten die Vorstellung einer natürlichen Zweigeschlechtlichkeit weiter zu verfestigen.
Hornscheidt plädiert stattdessen für einen nicht-diskriminierenden, nicht-festschreibenden Sprachgebrauch, der nicht darauf abzielt, das Verhältnis von Genus und Sexus und die geschlechtliche Identität von Menschen zu vereindeutigen. Im späteren Werk hat Hornscheidt Versuche unternommen, solche Sprachformen selbst zu schaffen, etwa durch die genderneutrale Endung -ens. So zum Beispiel statt Bürger, Bürgerin oder Bürger*in die neutrale Form Bürgens.