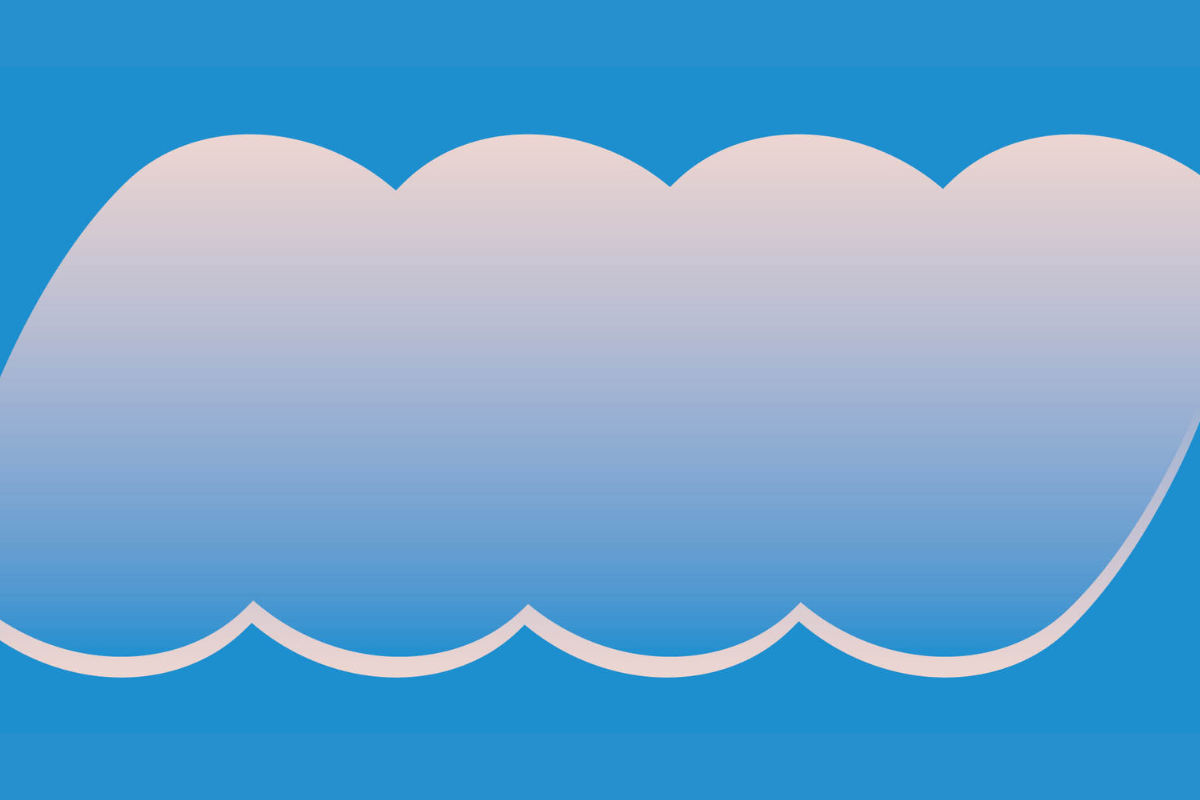Die Fragen stellte Sebastian Hoppe aus der Kuration des Themenkanals Umbruch | Krieg | Europa.
Sebastian Hoppe: Herr Heidenreich, steht Europa heute mit Blick auf die Ungleichheit besser oder schlechter da als vor der Gründung der Europäischen Union durch den
Martin Heidenreich: Wir sollten uns vergegenwärtigen, wie Osteuropa nach dem Fall der Berliner Mauer aussah: verarmte Länder mit nicht mehr funktionierenden, kollabierten Planwirtschaften. Nationale Grenzen waren in erheblichem Maße umstritten. Die politischen Systeme waren zusammengebrochen.
SH: Wie verändert sich die Bilanz, wenn wir den zeitlichen Rahmen auf die Jahre nach der globalen
MH: Sehr. Eine zentrale Entscheidung im Vertrag von Maastricht war die Einführung des Euro. Zwar kann man den Euro trotz aller Probleme als Erfolgsgeschichte betrachten, allerdings waren die Folgen aus südeuropäischer Sicht deutlich zwiespältiger.
Der Euro ist trotz aller Probleme eine Erfolgsgeschichte. Allerdings waren die Folgen aus südeuropäischer Sicht deutlich zwiespältiger.
Zunächst bedeutete die Einführung des Euro auch für Südeuropa eine Phase der Prosperität. Vorher mussten die Länder deutlich höhere Zinsen als Deutschland zahlen, ab 1999 lediglich so viel wie Deutschland. Die Folge war ein Boom, in Spanien etwa hat man in gigantischem Ausmaß Wohnungen gebaut. In anderen Ländern, zum Beispiel in Italien, hat man den öffentlichen Dienst ausgebaut oder, getrieben von populistischen Parteien, die Sozialausgaben erhöht. Dazu gehört, dass deutsche und französische Banken riesige Summen in Ost- und Südeuropa investierten.
Diese Phase endete abrupt mit der zunächst in den USA begonnenen Rezession.
SH: Diese Trends beziehen sich hauptsächlich auf zwischenstaatliche Ungleichheiten. Um die Verschränkung verschiedener Ungleichheiten in Europa zu beschreiben, verwenden Sie in Ihrem Buch Territorial and Social Inequalities in Europe. Challenges of European Integration den Begriff der „doppelten Dualisierung“. Was meinen Sie damit?
MH: Die EU ist ein Bündnis von 27 Nationalstaaten. Innerhalb dieser Länder gibt es innerstaatliche Unterschiede zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, aber auch zwischenstaatliche Ungleichheiten. Nun hat sich die EU aber zu einem transnationalen politischen Raum entwickelt, der durch zunehmend bedeutsamer werdende grenzübergreifende Gleichheitsstandards gekennzeichnet ist. Plastisch formuliert: Viele Bulgaren fühlen sich nicht nur arm, weil sie weniger verdienen als ihre reicheren Landsleute, sondern weil ihr Einkommen deutlich geringer ist als beispielsweise das Durchschnittseinkommen der Luxemburger. Soziale und territoriale Ungleichheiten prägen also beide die subjektiv wahrgenommenen Ungleichheiten und den wirtschaftlichen Stress.
SH: Sie nennen das die „Europäisierung der Ungleichheit“.
MH: Genau. Allerdings ist die Europäisierungsthese in der Forschung heftig umstritten. Die Kritik an ihr lautet, dass nur der Nationalstaat der entscheidende Referenzpunkt ist. Ich würde dagegen einwenden, dass bei einer konstanten innerstaatlichen Ungleichheit, gemessen anhand des
SH: Trotzdem scheint sich der politische Frust über soziale Ungleichheit vor allem in Form von populistischen Parteien auf nationalstaatlicher Ebene niederzuschlagen. Wie erklären Sie sich das?
MH: Ich bin überzeugt, dass soziale Ungleichheit in erheblichem Maße eine europäische Angelegenheit ist, die auch die EU angehen muss, wenn sie den Zusammenhalt des Kontinents sicherstellen will. Das werden wir auch 2024 bei den Wahlen zum Europaparlament sehen. Meine Befürchtung ist, dass die populistischen, euroskeptischen Parteien enorm an Bedeutung gewinnen werden und die bisher tonangebenden Sozialdemokraten und die Volkspartei nicht mehr weiterarbeiten können.
Die Frage ist, ob die euroskeptischen Parteien so sehr an Bedeutung gewinnen, dass die europäischen Institutionen – das Parlament, die Kommission und der Europäische Rat – blockiert werden. Es gibt einen massiven Konflikt zwischen den verschiedenen politischen Ebenen und auch eine Diskrepanz zwischen zunehmend grenzübergreifenden europäischen Problemen und der Hoheit der Nationalstaaten.
SH: Gibt es einen direkten Zusammenhang von sozialer Ungleichheit auf der einen und dem Aufstieg des Populismus auf der anderen Seite?
MH: Um das zu beantworten, ist die Entwicklung Mittel- und Osteuropas interessant. Diese Länder sind objektiv die Gewinner der letzten Jahrzehnte. Die Polen müssten also die glücklichsten Menschen auf der Welt sein. Aber Ideen und Interessen sind selten deckungsgleich. Dies hat
Allerdings haben die Menschen in den postsozialistischen Gesellschaften seit dem Ende des Kalten Kriegs einiges durchstehen müssen, ihre gesamte Lebenswelt wurde zerstört. Ganze Generationen haben ihre Selbstverständlichkeiten und ihre Existenzgrundlage eingebüßt. Die radikale Privatisierungspolitik war im Großen und Ganzen ein Erfolg, aber der Preis für viele Menschen war eben sehr hoch.
Ich befürchte, dass der EU Südeuropa um die Ohren fliegen wird.
SH: Können Sie das näher erläutern? Inwiefern unterscheidet sich die Situation in Südeuropa von der im Osten?
MH: Die beiden Peripherien der EU lassen sich gut miteinander vergleichen, denn beide haben ganz unterschiedliche Strategien gewählt. Mittel- und Osteuropa hat sehr stark auf die industrielle Produktion gesetzt. Es ist in der EU zu einem wichtigen Standort für Zulieferbetriebe geworden. Industrielle Tätigkeiten sind in erheblichem Maße verlagert worden, etwa von Deutschland nach Polen. Das Gleiche finden Sie auch in Slowenien oder Tschechien.
Für Europa bedeutete das einen doppelten Vorteil, denn die westeuropäischen Länder, vor allem Deutschland, konnten sich zum einen auf wissensbasierte oder höherwertige Produktionsprozesse, Forschung und Entwicklung konzentrieren. Zum anderen wurden einfachere Tätigkeiten nicht komplett nach China, Indien oder Vietnam ausgelagert, wie die USA das gemacht haben, sondern konnten in erheblichem Maße in Europa gehalten werden. Das ermöglichte einen raschen Anstieg der Wirtschaftsleistung in Mittel- und Osteuropa von 1993 bis zur
SH: Diese Strategie der „peripheren Industrialisierung“, wie Sie es nennen, wird von einigen kritisiert. Es heißt, sie schaffe neue Abhängigkeiten von den europäischen Kernländern, insbesondere Deutschland. Durch diesen „abhängigen Kapitalismus“ werde Osteuropa anfällig für Krisen im europäischen Zentrum.
MH: Natürlich sind diese Länder abhängig, Krisen der Automobilindustrie werden nicht auf Wolfsburg beschränkt bleiben. Es ist nur so: Viel schlimmer als ein abhängiges Industrialisierungsmodell ist das Ausbleiben von Industrialisierung. Sicherlich hat dieses Modell auch Schwächen, allerdings sehen wir mittlerweile in Mittel- und Osteuropa auch zunehmend wissensbasierte Produktionsprozesse und vor allem auch Dienstleistungen entstehen.
SH: Warum konnte dieses Modell nicht in Südeuropa Fuß fassen?
MH: Die Erfolge Mittel- und Osteuropas wurden nicht zuletzt durch die hohe Qualifikation der Arbeiter ermöglicht, die auch eine Folge des sozialistischen Wirtschaftsmodells ist.
SH: Schränkt nicht auch die Architektur des Euro die Länder Südeuropas ein? Früher stand ihnen das Mittel der
MH: Noch vor fünf Jahren hätte ich Ihnen mit voller Überzeugung recht gegeben. Schließlich gibt es die sog. Theorie optimaler Währungsräume:
Eine Alternative wären Transfers von wohlhabenden zu weniger wohlhabenden Ländern, um die Ungleichgewichte in einem gemeinsamen Währungsraum auszugleichen. Transfers aber sind laut Vertrag von Maastricht auch verboten, unter anderem, weil Helmut Kohl und die Bundesbank vehement dagegen gekämpft haben.
SH: Ist diese reale Abwertung in Form der Austeritätspolitk für die Dauerkrise in Südeuropa verantwortlich?
MH: Das mag sein, das müssen Wirtschaftswissenschaftler untersuchen.
SH: Dennoch trifft es ja zu, dass es massive ökonomische und soziale Verwerfungen in Südeuropa im Zuge der Eurokrise gegeben hat. Sind das für Sie alles hausgemachte Probleme?
MH: Davon bin ich zunehmend überzeugt. Die südeuropäischen Staaten haben ein
Südeuropa ist eher ein Opfer seines eigenen Wachstumsmodells als ein Opfer des Euro.
Die südeuropäische Wirtschaft kann sich nicht auf ein modernes Ausbildungssystem und ein leistungsfähiges Forschungs- und Entwicklungssystem stützen (mit Ausnahme einiger Regionen etwa in Norditalien oder in Spanien). Zudem wird auf dem Arbeitsmarkt immer noch stark auf den Ausschluss mancher Gruppen aus dem Arbeitsmarkt gesetzt: Die Erwerbstätigenquoten von Frauen, Jugendlichen und Älteren sind geringer als in anderen europäischen Ländern. Und Migranten setzt man unterhalb ihres Qualifikationsniveaus ein.
SH: Wir haben jetzt viel über Unterschiede zwischen den europäischen Staaten gesprochen. Welche innerstaatlichen Ungleichheiten halten Sie in Europa für besonders besorgniserregend?
MH: Am wichtigsten ist wohl die zunehmende Bedeutung der sog.
In meinem Buch zeige ich, dass sich die Ungleichheiten zunehmend verlagern. Sie beruhen nun auf individuellen schulischen oder beruflichen Verdiensten. Unqualifizierte werden abgehängt. Leute, die in der Schule scheitern oder nicht sehr erfolgreich sind, sind die großen Verlierer. Das sieht man aber nur, wenn man soziale Ungleichheiten breiter betrachtet und weggeht von einer rein wirtschaftlichen, auf Einkommen bezogenen Perspektive. Ich habe das mit einem multidimensionalen Armutsindex versucht. Man sieht ganz deutlich, dass diese meritokratischen Ungleichheiten Deprivation, Bildungsarmut und subjektive Armut verursachen. Zu großen Teilen betrifft das die Verlierer des Bildungssystems.
Zugeschriebene Ungleichheiten sind natürlich immer noch da, denken Sie nur an den
SH: Warum ist diese neue Spaltung Ihrer Meinung nach besorgniserregender als die alten, auf zugeschriebenen Ungleichheiten beruhenden Spaltungen?
MH: In der Arbeitswelt beobachten wir eine Subjektivierung der Arbeit, die mit einer zunehmenden Entgrenzung einhergeht.
SH: Wie schlägt sich das politisch nieder?
MH: Meine Befürchtung ist, dass diese Ressentiments immer unkontrollierter explodieren. Steffen Mau beschreibt das in seinem Buch Triggerpunkte.
SH: Sie sprechen den gesellschaftlichen Zusammenhalt an. Wie wirken sich Migrationsströme auf Ungleichheitsstrukturen in Europa aus? Sehen Sie eine Überforderung oder zeichnen sich zukünftige Lösungen ab?
MH: Die etwa eine Million Ukrainer, die in Deutschland leben, sind volkswirtschaftlich ein riesiger Gewinn. Drei Viertel von ihnen haben einen akademischen Abschluss. Viele wollen natürlich nach dem Krieg zurückkehren. Aber es wird ohne Frage Klebeeffekte geben. Das heißt, Hunderttausende werden in der EU bleiben, wenn sie vernünftig integriert sind. Bereits jetzt ist ein Fünftel der hier lebenden Ukrainer erwerbstätig. Bei Schutzsuchenden aus anderen Ländern, die schon länger in der EU sind, sieht es noch besser aus. Die Hälfte der 2015 Immigrierten hat Jobs, wenn auch meistens solche mit niedrigen Qualifikationsanforderungen.
Ein großes Thema bei der Integration von Migranten ist die bereits erwähnte overeducation, also der unterwertige Einsatz von Migranten in der Wirtschaft. Gemeinsam mit meinem Kollegen Sven Broschinski habe ich untersucht, wie Migranten und Einheimische eingesetzt werden und ob ihre Ausbildungen richtig genutzt werden. Wir sehen deutlich, dass overeducation insbesondere bei Migranten weit verbreitet ist. Wenn wir auf die EU blicken, sehen wir eine interessante Spaltung: EU-Bürger werden unterwertig eingesetzt, weil es ein Defizit bei der Sprachkompetenz gibt, etwa wenn ein Italiener versucht, in Deutschland zu arbeiten. Zwar gibt es auch einen unterwertigen Einsatz von Einheimischen, aber der dramatischste Unterschied besteht zwischen Einheimischen und Drittstaatsangehörigen.
SH: Wie kann die EU hier gegensteuern?
MH: Die EU-Regeln tragen bereits jetzt in erheblichem Maße dazu bei, dass innereuropäische Migranten adäquat eingesetzt werden, wenn man die Sprachbarriere ausklammert. Die EU bietet in dieser Hinsicht viele Vorteile. Es gibt zum Beispiel bestimmte Regeln, die im Rahmen des gemeinsamen Binnenmarktes dafür sorgen, dass Qualifikationen anerkannt werden. Das gilt jedoch in deutlich geringerem Maße für Drittstaatsangehörige. Auf die Frage, warum bei Letzteren sprachliche Defizite mehr ins Gewicht fallen als bei EU-Bürgern, haben wir in unserer Forschung auch eine Erklärung vorgeschlagen: Drittstaatsangehörige können ihren Aufenthalt in einem bestimmten Land der EU nicht planen, da sie als Schutzsuchende kommen. Welche Sprache konkret benötigt wird, ist zunächst nicht vorhersehbar. Auch Antidiskriminierungspolitik, die oft belächelt wird, aber in der Praxis Vorurteile abbaut, hilft ungemein. Das kann man empirisch zeigen.
SH: Weiten wir zum Schluss noch mal den Blick. Inwiefern unterscheiden sich die Ungleichheiten, die Europa kennzeichnen, von jenen in den USA oder China? Wo zeigen sich in Europa globale Trends und was ist spezifisch europäisch?
MH: Im globalen Maßstab ist Europa eine Insel der Seligen. Betrachtet man die EU als ein einheitliches Gebiet, ist der Gini-Koeffizient mit ungefähr 0,32 weit geringer als in den USA oder China. Auch die zwischenstaatlichen Ungleichheiten sind, wie eingangs beschrieben, in Europa deutlich zurückgegangen. Die USA haben einen Gini-Koeffizienten von 0,38, sind also deutlich ungleicher als Europa. Die tatsächliche Ungleichheit in China ist ein großes Rätsel, es gibt nur Schätzungen. Der Gini-Koeffizient liegt wohl bei etwa 0,50. Es gibt eine dramatische Ungleichheit zwischen den entwickelten südchinesischen Regionen und den westlichen und nördlichen abgehängten Regionen.
Europa hat viel bessere Voraussetzungen, um gezielt Politik gegen Ungleichheiten zu machen. Und es passiert ja auch viel: Denken Sie an das riesige Investitionsprogramm Next Generation der Von-der-Leyen-Kommission. Man versucht, mit einem gigantischen finanziellen Aufwand von 800 Milliarden Euro insbesondere Ungleichheiten zwischen Nord- und Südeuropa zu reduzieren. Die größten Profiteure sind Italien und Spanien. Es freut mich enorm, dass sich die EU damit ein neues Politikfeld erschlossen hat.