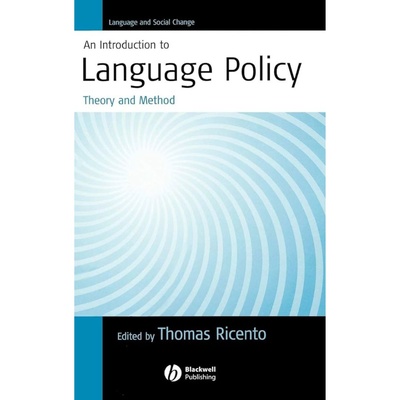In den 1980er und 1990er Jahren sind eine Reihe von historischen und sozialwissenschaftlichen Arbeiten entstanden, die heute als klassische Analysen des Nationalismus und der Entstehung moderner Nationalstaaten gelten. Zu nennen sind unter anderem Benedict Andersons Imagined Communities, Ernest Gellners Nations and Nationalism oder die Arbeiten des Historikers Eric Hobsbawm.
Dies charakterisiert Blommaert mit Rückgriff auf die Arbeiten der amerikanischen Anthropologen Richard Bauman und Charles L. Briggs
Es sei auf diesen doppelten Prozess zurückzuführen, folgert Blommaert, dass Sprachen heute als abstrakte, in sich abgeschlossene Entitäten erscheinen: Sprachen wie „Deutsch“, „Englisch“ oder „Zulu“ – „definiert als Set von dekontextualisierten Regeln und Normen, eingeschlossen in nationale Räume, in denen sie zu Emblemen nationaler Identität werden konnten.“
Es handelt sich also um standardisierte Nationalsprachen. Mit ihnen, postuliert Blommaert schließlich, würden innerhalb von Staaten zwei zentrale soziolinguistische Regime gestützt: Ihre Kompetenz bedinge zum einen Regime der nationalen Identität und Zugehörigkeit, zum anderen Regime der sozialen Hierarchie. Die Vorstellung einer nationalen Identität drehe sich meist um eine einsprachige, imaginäre Eins-zu-eins-Beziehung zwischen national-administrativer Zugehörigkeit und Sprachgebrauch. Mit einer bestimmten Staatsbürgerschaft sei also die Erwartung verbunden, eine bestimmte Sprache alltäglich als Erstsprache zu benutzen. Diese Erwartung könne sich auch in Form eines normativen Anspruchs präsentieren: In Deutschland spricht man Deutsch! In Tansania spricht man Swahili!
Blommaert betont, dass es sich bei solchen Vorstellungen um ideologische Prozesse handelt, die nicht unbedingt die empirische Realität reflektieren müssen. Dabei folgt er dem amerikanischen Linguisten Michael Silverstein, der zwischen linguistischen und sprachlichen Gemeinschaften unterscheidet. Als linguistische Gemeinschaften bezeichnet Silverstein Gruppen, die sich ideologisch zur normativen Aufrechterhaltung von Standardsprachen bekennen. Als sprachliche Gemeinschaften bezeichnet er hingegen Gruppen, in denen bestimmte Varietäten (Dialekte, Jargons, oder auch Standardsprachen) tatsächlich monolingual verwendet werden. Beide Arten von Gruppen können, müssen aber nicht deckungsgleich sein.
Nationalstaaten tendierten laut Blommaert dazu, sich als linguistische Gemeinschaften zu verstehen, ohne dass sie tatsächlich sprachliche Gemeinschaften bilden. Sie seien so von dem geprägt, was Silverstein als monoglotte Ideologie bezeichnet: Die Gesellschaft wähnt sich demnach im Glauben, in Einsprachigkeit zu leben, während alltäglich stattfindende multilinguale Praktiken verkannt werden. Innerhalb dieses monoglotten Denkens erscheine der Staat schließlich als Hüter einer natürlichen Verbindung zwischen Sprache, Volk und Land. Zentral sei dabei die Identität eines „einsprachigen Sprechers der Landessprache“, die als organisches Merkmal der Zugehörigkeit zu diesem Land verstanden werde.
Dergestalt biete der Staat seinen Bürger*innen eine bestimmte ethnolinguistische Identität an – oder zwinge sie ihnen auf. Denn monoglotte Ideologie könne dazu führen, dass sprachliche Vielfalt im öffentlichen Leben nicht nur geleugnet, sondern tatsächlich eingeschränkt werde. Dabei müsse es sich keinesfalls um offensichtlich invasive Eingriffe wie Verbote handeln. Stattdessen seien die Prozesse, mit denen eine monoglotte Ideologie eingeübt werde, oft implizit und unspektakulär – etwas, das sich u.a. in der Schulbildung vollzieht. Es handele sich um vielfach unbewusste, automatisierte Vorgänge, in denen die Menschen durch den Staat nahegelegte Identitäten alltäglich einüben.