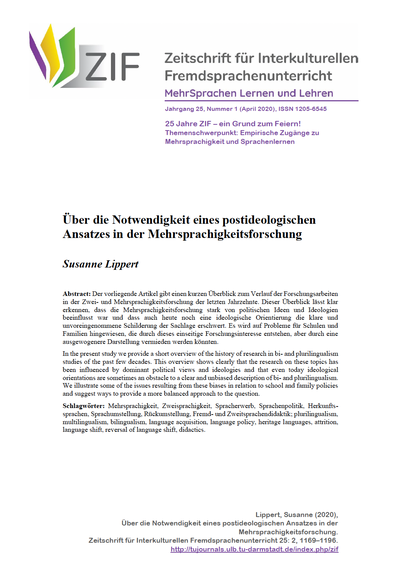Mehrsprachigkeit kann einige Vorteile haben: So erkennt z.B. Olga Grjasnowa im eigenen mehrsprachigen Familienleben ein hohes kulturelles Gut, viele junge Menschen rechnen sich durch ihr Sprachrepertoire bessere Karrierechancen aus und Heike Wiese et al. befürworten mehrsprachigen Schulunterricht als Hebel für mehr Bildungsgerechtigkeit. Auch die linguistische Forschung erachtet sie heute als vorteilhaft. Diese allgemein positive Haltung zur Mehrsprachigkeit gab es jedoch nicht immer, betont Susanne Lippert und teilt die Mehrsprachigkeitsforschung in drei Phasen ein: 1. Bilingualismusfeindlichkeit (Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 1960er), 2. Bililingualismuseuphorie (ab Mitte der 1960er) und 3. Normalisierung der Positionen (Gegenwart). Sie vergleicht die drei Phasen mit einem Pendel, das sich derzeit auf dem Rückweg zur Mitte befindet.
In der ersten Phase dominierte die Vorstellung, zweisprachige Kinder seien „mental verwirrte Individuen“, denn das menschliche Gehirn habe für zwei komplette Sprachen nicht genügend Kapazitäten. Die Ursprünge dieser bilingualismusfeindlichen Ansichten sind im frühen 20. Jahrhundert in den USA zu finden, berichtet die Autorin. Die vermehrte Einwanderung aus armen südeuropäischen Ländern sollte eingedämmt werden. Ein Mittel dazu waren Lese- und Schreibtests auf Englisch, die ab 1917 vor der Einbürgerung durchgeführt wurden. Mit diesen Tests an Immigrant*innen, die nur sehr geringe Englischkenntnisse vorweisen konnten, sollte bewiesen werden, dass sie nur deswegen die Sprache nicht beherrschten, weil sie über zu geringe intellektuelle Fähigkeiten verfügten. Und sogar wenn sie die Sprache gelernt hatten, wurde ihnen unterstellt, dass sie aufgrund der Sprachverwirrung – die das Sprechen zweier Sprachen bedeutete – geistig zurückbleiben würden. Ursprünglich ging es im politischen Diskurs also nicht um sprachwissenschaftliches Interesse an Zweisprachigkeit, sondern darum, die Ungleichbehandlung von Immigrant*innen zu legitimieren.
Die zweite Phase der Mehrsprachigkeitsforschung – die Bilingualismuseuphorie – begann Anfang der 1960er Jahre, als die kanadischen Forschenden Peal und Lambert
Die Autorin betont bezüglich des kulturellen Zusammenhangs der oben genannten Studien, dass „keineswegs eine direkte Beeinflussung der Forschung von Seiten der Politik postuliert wird. Es wird hier lediglich festgestellt, dass sich Forschung nicht in einem luftleeren Raum entwickelt, sondern zu einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten politischen Situation. Diese politischen und gesellschaftlichen Konstellationen wirken sich indirekt auf das Forschungsinteresse aus, da sie die Grundeinstellungen der Gesellschaft und somit auch der Forscher und Forscherinnen mit beeinflussen.“ Dieser Faktor soll auch heute mitbedacht werden, fordert Lippert. Die heutige Phase der „Normalisierung der Positionen“ sei noch sehr durch die Bilingualismuseuphorie geprägt. Mythen zu den Themen Sprachenlernen und Sprachvielfalt würden zu wenig hinterfragt.
Ein solcher Mythos sei die Betrachtung von Mehrsprachigkeit als Normalität. Dass sich mehrere Tausend Sprachen auf ca. 200 Länder verteilen, bedeute nicht zwangsläufig, dass die meisten Menschen mehrsprachig seien. In vielen Ländern dominiere im Gegensatz eine einzige Amtssprache und viele kleine Sprachen würden von der Mehrheit der Bevölkerung nicht wahrgenommen. Ein weiterer Satz, den die Autorin als Mythos bezeichnet, lautet: „Wir sind zur Mehrsprachigkeit geboren“. Gegenargumente, die unterstreichen, dass eben nicht alle Menschen zur Mehrsprachigkeit geboren sind, fänden sich in vielen migrantischen Gemeinschaften, in denen die Herkunftssprache nach und nach aus dem Alltag verschwinde.
Der dritte Mythos lautet: „Bilingualer Spracherwerb ist ein Kinderspiel“. Jürgen Meisel
Lippert legt einen besonderen Fokus auf fünf Kinder, die zum Ende der Studie Deutsch nur auf einem
Die Kompetenz von bilingualen Kindern in ihrer Herkunftssprache lässt sich nicht mit der Sprachkompetenz von monolingualen Kindern vergleichen, ist Lipperts Fazit. Wenn zu hohe Ansprüche an die Sprachfähigkeiten der Kinder gestellt werden, könne dies zu Frustration auf allen Seiten führen. Schwierigkeiten beim Spracherwerb von zwei Sprachen in einer monolingualen Umgebung zu verharmlosen und dieses Ungleichgewicht zu ignorieren, ziehe weitere Probleme nach sich und sei unfair gegenüber den bilingualen Kindern. Dies sollten Eltern, Lehrende und Forschende berücksichtigen, um bessere Bedingungen für den Spracherwerb und die Integration in Schulen zu schaffen, appelliert die Autorin.